Wenn beten sinnlos erscheint und einem die Worte fehlen. Von Bryan Gallant
»Die Welt bricht jeden, aber danach sind manche an den Stellen stark, wo sie gebrochen wurden.« – Ernest Hemingway
Ich wachte schließlich auf, nachdem die Wirkung der Medikamente nachgelassen hatte. Die Sonnenstrahlen, mit denen der 4. Dezember anfing, widerten mich an, als ich aus dem Fenster schaute. Meine Welt hatte aufgehört zu existieren, doch die Zeit marschierte weiter und wartete auf niemand. Wie Galle spürte ich die Bitterkeit in mir aufsteigen. Alles zwecklos und endgültig! Bei jeder Bewegung tat mir irgendetwas weh. Der Beweis dafür, dass es kein gruseliger Traum war. Meine neue Wirklichkeit war innere und äußere Gebrochenheit.
Der Versuch eines neuen Tages
Ich duschte und versuchte dabei alles wegzuwaschen, was ich gesehen hatte. Doch die Seife konnte den Fleck im Herzen nicht beseitigen: die Erinnerung an meine eigene tote Tochter in meinen Händen. Anders als die blutigen und schuldbeladenen Visionen der Lady Macbeth, die sie des Nachts unruhig hin- und hertrieben, würde der Beweis meines Versagens und Verzagens mich am helllichten Tag verfolgen, und das für den Rest meines Lebens. Schließlich wich der unkontrollierbare Impuls, meine Welt zu ertränken, und ich trocknete mir die Tränen.
Dann betete ich. Schon gestern hatte ich kurz vor dem Einschlafen wie im Fieberwahn gebetet. Warum?
Warum, warum?
Warum betete ich überhaupt? Ich war mir völlig unsicher, wer oder wo Gott gerade war. Ich fragte mich: Warum beten wir? Was erhoffen wir uns davon? Was ist Gebet?
Meine Familie und ich hatten weniger als vierundzwanzig Stunden zuvor um eine sichere Heimreise gebetet. Wir hatten Gott dafür gedankt, dass wir anderen dienen durften und ihnen zum Segen sein konnten. Mit welchem Ergebnis? Meine Familie war nun getrennt und befand sich an drei unterschiedlichen geographischen Orten: (1) Meine Kinder lagen eiskalt in irgendeinem Raum und warteten auf die Autopsie. Die genaue Todesursache sollte festgestellt werden, um zu beweisen, dass die Autositze korrekt angeschnallt waren, falls die Versicherung oder die Behörden Klage auf widerrechtliche Tötung einreichen würden. (2) Meine Frau war an so vielen Apparaten angeschlossen, wie ich es noch bei keinem Menschen gesehen hatte. Ihr Leben hing am seidenen Faden. (3) Und ich selbst war ein gebrochener, nutzloser Vater, der zwar noch umherlaufen konnte, aber keinen Grund mehr hatte, nach Hause zu gehen. Dieses Gebet schien ein kolossaler Fehlschlag gewesen zu sein!
Warum also beten? Hatte ich mir Gott als göttlichen Butler vorgestellt, der nur darauf wartete, mir alle Wünsche von den Lippen abzulesen, entdeckte aber nun, dass es von seiner Laune abhängt, ob er meine Wünsche auch erfüllt, ob er Ja sagt oder Nein? Oder war ich der Meinung, dass meine Gebete dann beantwortet würden, wenn ich genug Glauben hätte? Das hatte ich schon gehört und auch in der Heiligen Schrift gelesen. War also mein mangelnder Glaube das Problem und daher der Grund für den Tod meiner Kinder und den Überlebenskampf meiner Frau? War ich schon wieder schuld? War mein »Glaubenskonto« nicht voll genug, um diese Katastrophe abzuwenden? War dies ein riesiger ungedeckter Scheck auf meinem Lebensbankkonto? Warum hatte Gott mir nicht einfach einen Kredit gewährt? Ihn hätte ich gerne zurückgezahlt, auch durch die ganze Ewigkeit hindurch, falls nötig. War Gott ein gefühlloser Richter, der einfach das Urteil der Geschworenen verlas und die Strafe für meinen mangelnden Glauben verkündete? Beten wir, weil es einfach zu unserer Kultur und Gewohnheit gehört? Ist das Gebet ein Talisman? Ich hatte keine Ahnung mehr. Doch ich betete und hielt an der unwirklichen Hoffnung fest, dass Gott mich erhören und mir dann zu Hilfe eilen würde. Ich wusste jedoch nicht einmal, worum ich bitten sollte. Darum, dass Penny überlebte? Was, wenn sie geistig bleibende Behinderungen zurückbehalten würde? Was, wenn das Schädel-Hirn-Trauma zu schwer war und sie nie mehr dieselbe sein würde? Wollte ich, dass sie unter solchen Umständen am Leben bliebe? Was für eine schreckliche Frage. Und ich?
Was wollte ich?
Ich wollte das Unmögliche: dass jemand die Zeit zurückdreht und alles rückgängig macht. Doch wie weit zurück? Bis zur letzten Umarmung oder zu dem Tag, an dem Abigail ihre ersten Schritte machte? Oder bis zum Morgen des besagten Tages, damit ich meiner Frau liebevoller begegnen konnte. Oder vielleicht noch weiter zurück, um die Probleme aufzudröseln, an die wir uns gewöhnt hatten, oder um die mit Videospielen verschwendeten Stunden dafür zu verwenden, ein besserer Vater und Partner zu sein? Die Frage »Was wäre gewesen, wenn?« ergriff derart von meinen Gedanken Besitz, dass mir ganz schwindelig wurde. Ideen, Szenarien tauchten auf und verschwanden, einige besser als andere. Doch all das führte zu nichts. Verzweiflung, Zorn, Angst und Hoffnungslosigkeit vertrieben das Gebet aus meinem Bewusstsein und setzten sich fest. Es würde viele Monate dauern, bevor sie meinen Geist nicht mehr im Griff haben würden.
Ich zog mich an.
Ich bedankte mich bei Greg, der bei mir geblieben war, und wir standen auf, um nach meiner Frau zu schauen. Hatte sie die Nacht überlebt? Wir stolperten aus der Tür und strebten dem Krankenhaus zu. Unterwegs erzählte er mir von besorgten Anrufen, wer alles betete und von der Anreise meiner Familie. Mein Bruder, meine Schwester und meine Großeltern warteten schon in der Cafeteria, auf die wir zuliefen. Wollte ich etwas essen? Essen? Das war wohl wichtig. Ich dachte nur an meine Familie.
Wieder Kind sein
Augenblicke später betraten wir die Cafeteria und mein Blick fiel auf meine Familie. Obwohl sie müde und ihre Gesichter tief von Sorge zerfurcht waren, sprangen sie auf und umarmten mich. Greg schien wie vom Erdboden verschluckt. Er wusste, dass ich jetzt bei ihnen gut aufgehoben war und sie übernahmen die Verantwortung gerne, als ich ihnen in die Arme fiel und hemmungslos weinte. Mein zwei Jahre jüngerer Bruder Jeff war immer der Stärkere gewesen in unseren freundschaftlichen Raufereien. Auch jetzt hielt er mich fest, als ich in Tränen ausbrach – seine erste Dusche an diesem Tag; er war die ganze Nacht durchgefahren.
Grandparents Lowell and June Freeman
Oma und Opa Freeman strahlten wie immer Treue und Liebe aus. Vor Jahren hatten sie sowohl Jeff als auch mich bei sich aufgenommen, obwohl sie es nicht hätten tun müssen. Ihr Sohn Dean hatte sich entschlossen, meine Mutter zu heiraten, eine geschiedene Frau, ein paar Jahre älter als er, mit zwei unbändigen Buben (vier und sechs Jahre alt), die eindeutig schon zwei Jahre lang ohne Vater gewesen waren. Dennoch wollte er die Verantwortung für eine Familie mit seinen nur 22 Jahren übernehmen. Er war gerade mal 16 Jahre älter als ich damals! Im Rückblick bewundere ich seine erstaunliche Bereitschaft und Tapferkeit, sein Glück mit der Liebe und mit uns zu versuchen.
Die Entscheidung meines Papas wird mich immer daran erinnern, was ein gut geführtes Leben bewirken kann und wie unsere Entscheidungen andere in einem Ausmaß beeinflussen, das uns nie bis ins Letzte bewusst sein wird. Doch Opa und Oma übertrafen seine Entscheidung, meine Mutter und uns Buben zu lieben. Sie schenkten uns wieder die Gelegenheit, ein Zuhause zu haben. Sie bestanden nicht auf einer engen Definition von Familie, sondern nahmen uns in den großen Freeman-Klan auf, ohne jede Rücksicht auf Blutsbande oder unsere Vergangenheit. Sie liebten uns und ließen uns das auch wissen. Wir waren ein Teil ihrer Familie, obwohl keine genetischen Zusammenhänge bestanden. Die Art, wie sie Jeff und mir an jenem Morgen zur Seite standen, war bezeichnend für die Liebe, die sie uns all die Jahre geschenkt hatten.
Durch meine Tränen sah ich meine 17-Jährige Schwester, Stephanie. Sie saß weinend außerhalb des Kreises an einem Tisch und versuchte eine Trauer zu verarbeiten, die man nicht begreifen konnte. Diese tragische Nachricht hatte sie aus den Plänen für die Adventsfeier an ihrer Schule gerissen und ihr Leben ins Chaos gestürzt. Sie litt mit ihrem ältesten Bruder, dessen Familie sich soeben aufgelöst hatte. Es war ein entscheidender Augenblick in ihrem eigenen Leben, in dem sie mit ansehen musste, wie meine Familie dahingerafft wurde. Es traf sie tief ins Herz. Obwohl ich es durch meinen Schmerz damals nicht wahrnehmen konnte, hinterließ der Tod meiner Kinder eine Narbe in ihrem Leben, die sie für Jahre beschäftigen würde.
Penny, wirst du leben?
Schließlich ließ der Drang zu weinen nach und wir aßen etwas. Nach der eigenartigen Atmosphäre beim Essen, in der wir nicht wussten, worüber wir reden sollten, gingen wir alle hinauf zu Penny. Ich wusste inzwischen, dass sie die Nacht überlebt hatte, aber in was für einem Zustand? Die Ärzte ließen sie absichtlich bei Bewusstlosigkeit aus Gründen, die ich nicht verstand. Anscheinend wollten sie ihr während dieser kritischen Stunden jeglichen Kampf ersparen. Sie warteten darauf, dass die Schwellung abklang oder dass sie … einfach aufgab und starb. Niemand sprach darüber.
Als ich das Zimmer betrat, war ich entsetzt, meine Frau in ihrem geschwollenen Zustand zu sehen. Wieder sprangen mich die Schläuche, Geräusche und Gerüche an. Man hatte sie ein wenig gesäubert, doch die tragischen Andenken an unsere Feuerprobe waren immer noch in ihrem verfilzten Haar zu sehen. Sie wusste nicht, dass ich da war. Die anderen warfen einen kurzen Blick auf sie, dann gingen wir alle in einen anderen Raum und warteten auf irgendeine Auskunft des Arztes.
Später am Tag traf Pennys Mutter Anna ein und wurde zu ihrer Tochter gebracht. Als sie Pennys Krankenzimmer betrat, konnte sie nicht glauben, dass die Person vor ihren Augen ihre eigene Tochter war, so stark war die Schwellung. Sie hatte buchstäblich alle Vertiefungen in Pennys Gesicht ausgefüllt und ihren Kopf so vergrößert, dass selbst ihre eigene Mutter sie nicht mehr erkennen konnte! Meine Familie tat ihr Bestes, um Anna in ihrem Schmerz aufzufangen. Ich selbst hatte nichts, was ich irgendjemand hätte geben können. Anna ließ ihren Tränen freien Lauf, als der Verlust ihrem Herzen zusetzte: ihre ersten Enkel waren gestorben und ihre liebe Tochter lag auf der Schwelle des Todes.
Die Ärzte gaben ihr Bestes, um uns alle zu trösten und versuchten uns auf die durchaus reale Möglichkeit vorzubereiten, dass Penny schwere Hirnschäden davontragen würde, wenn (wieder jenes gehässige Wörtchen) sie überleben sollte. Sie ließen uns wissen, dass man sie bald aus ihrem durch Medikamente verursachten Schlaf herausholen würde, um zu sehen, was geschehen würde. Wir warteten.
Ein paar Stunden vergingen, während wir uns gegenüber saßen mit übervollen Herzen, aber ohne Worte. Gebete stiegen empor und immer mehr Freunde trafen ein und taten ihr Bestes, um uns zu trösten. Wir weinten zusammen. Der Schauer von Beileidskarten, Geschenken und Umarmungen überwältigte mich. Sie taten mir alle gut, doch schließlich siegte die Benommenheit. Dieselben Fragen, immer und immer wieder; der Schmerz und der Verlust ständig neu; dieselben aufrichtigen Worte der Fürsorge, des Trostes und Gebets, die Hoffnung in mein hoffnungsloses Leben bringen wollten.
Gegen Abend trafen Mama und Papa ein. Sie waren den ganzen Weg von Anchorage in Alaska gekommen. Durch den unermüdlichen Einsatz des Roten Kreuzes konnten sie ihre Flüge umbuchen und schafften alle knappen Anschlüsse, um die Tausende von Kilometern bis an meine Seite zu überwinden. Eigentlich wären sie erst eine Woche später gekommen, um uns zu besuchen: Mama hätte Abigail das erste Mal gesehen (Papa hatte sie schon im Jahr zuvor gesehen). Danach wollten sie dem freudigen Anlass der Hochzeit meines Bruders am 18. Dezember beiwohnen. Jetzt war alles anders gekommen. Es gab keine Enkel zum Spielen und Knuddeln mehr und auf Glück für Jeff und Annemaries Hochzeit könnte man nur hoffen, wenn Gott einem die Gnade dazu schenkte und/oder man Teile der Vergangenheit einfach ausblendete. Meine Eltern nur zu sehen, ließ den Damm erneut brechen. Die Tränen hüllten uns ein, als wir uns umarmten.
Schließlich sagten die Ärzte, ich könne hineingehen, Penny sehen und versuchen, mit ihr zu reden; denn die Wirkung der Medikamente hätte ausreichend nachgelassen, dass sie reagieren könne, wenn es noch eine Reaktion geben würde (Ich fing jenes Wörtchen allmählich zu hassen an).
Leise gingen Jeff und ich hinein. Ich konnte nicht alleine gehen. Ich stand am Bett meiner Frau und traute mich nicht zu hoffen. Ich hatte Angst davor zu erfahren, ob sie je wieder sprechen würde. Wir warteten. Langsam trotzte ich meinen Ängsten und berührte ihren rechten Arm.
Er bewegte sich!
Schockiert begann ich zu ihr zu reden und beugte mich immer näher über sie, um alles aufzuschnappen, was sie sagen könnte. Die Hoffnung kämpfte sich zeitweise frei aus dem Schwitzkasten der Verzweiflung. War Penny tatsächlich immer noch da drinnen? War es möglich, dass sie diese schreckliche Feuerprobe überlebt hatte?
Die ersten Worte
Die Sekunden tickten in Zeitlupe. Sie schien zu wissen, dass ich da war und öffnete langsam ein Auge, um nach mir zu suchen! Eine Welle der Hoffnung drängte mich vorwärts. Jeff kam näher und hielt mich fest, damit ich mich nicht auf ihren gebrochenen Körper stützen würde. Sie lächelte nicht, denn sie konnte ihr Gesicht bei all der Schwellung kaum bewegen. Doch ihre Augen suchten. Dann sah sie mich!
Meine Frau war irgendwo da drin. Langsam öffnete sie den Mund und begann zu sprechen. Meine Erwartung wuchs, als sie versuchte ihren Atem mit beiden kollabierten Lungenflügeln wiederzufinden, die am Beatmungsapparat hingen. Ich hörte sie erst nicht, deshalb flüsterte sie es noch einmal. Meine tapfere, liebe Penny; was würde sie sagen? Ihre ersten Worte kamen ihr fast nicht über die Lippen: »Wo … sind … die … Kinder?«
Wieder schien meine Welt zusammenzubrechen. Die kurzzeitige Hoffnung zog sich vor der erdrückenden Welle der Verzweiflung und des Grauens zurück, als mir klar wurde, dass sie es nicht wusste! Natürlich, es hatte ihr ja niemand sagen können. Sie war ja bewusstlos gewesen. Wie jede liebende Mutter kämpfte sie um das Leben und das Wohlergehen ihrer Kinder. Ihr erster bewusster Gedanke galt ihren Kleinen.
O Gott! Warum ich?
Die Finsternis bearbeitete mich mit Fäusten. Was sollte ich tun? Konnte ich es wagen, ihr zu sagen, dass sie tot waren und sie sie nie mehr in den Arm nehmen konnte? Wie könnte ich das tun? Wo waren jetzt die Ärzte? Hatten nicht sie die Aufgabe, es ihr zu sagen? Fiel denn jetzt mir die Verantwortung zu, ihr die schlimmste Nachricht zu bringen, die eine Mutter je hören kann? Wenn man es ihr sagte, bestand die Wahrscheinlichkeit, dass ihr auch noch das letzte Fünkchen Überlebenswille geraubt würde. Caleb und Abigail waren ihr Leben. Ich war es mit Sicherheit nicht. Alle meine Probleme und mein Versagen hatten sie über die Jahre tief verletzt; für mich zu kämpfen, würde sich keinesfalls lohnen.
Vergeblichkeit, Versagen und Verzagen verbargen mich unter sich. Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung stürzten sich auf mich, traten mich, bearbeiteten mich mit Fäusten, pressten das Leben aus mir heraus. Meine Beine knickten ein, die Gebrochenheit brach aus mir hervor. Ich konnte nicht mehr stehen. Jeffs Arme umschlossen mich fester und ich hörte mich die Worte in Pennys Ohr flüstern: »Sie sind gestorben, Schatz, sie sind tot.«
Ihre Augen schlossen sich. Stille! Die Gebrochenheit überwältigte mich wie einen Gefangenen, der in die Zelle der Hoffnungslosigkeit gesperrt wird.
Fortsetzung Teil 1 der Serie In Englisch
Aus: Bryan C. Gallant, Undeniable, An Epic Journey Through Pain, 2015, Seite 42-50

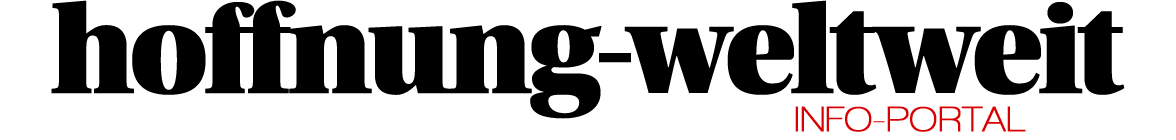


Schreibe einen Kommentar