Wenn man sich Fragen stellt, die man sich nie stellen wollte, und Freunde da sind, die einen auffangen. Von Bryan Gallant
»Willst du als Person wachsen und lernen, dann erkenne, dass du vom Universum in den Studiengang ›Verlust im Leben‹ eingeschrieben bist.« – Elizabeth Kübler-Ross
Mit einem Schlag fiel ich in ein tiefes Loch. Bildlich gesprochen. Aber es ändert nichts an der Wirklichkeit. Die Wände dieses hoffnungslosen Ortes wird jede Person anders beschreiben. Doch »Last« und »Finsternis« sind Worte, die man immer wieder hört im Zusammenhang mit dem, was wir Verlust oder Trauer nennen.
Verhör am Unfallort
Durch meinen benebelten Zustand damals erinnere ich mich nur schwach an das, was um Penny und das Auto herum vor sich ging. Ein Polizeibeamter kam zu mir und stellte mir eine Menge Fragen. Name, Wohnort, Personalausweis usw. »Setzen Sie sich ruhig!«, sagte er. Ich setzte mich und ließ das Verhör über mich ergehen, obwohl ich am liebsten herumgerannt wäre und etwas anderes gemacht hätte – egal was! Doch er hörte nicht auf, mir Fragen zu stellen. Frustriert, durcheinander und unter Schock fuhr ich ihn schließlich an: »Sie sind bestimmt froh, dass ich bei Bewusstsein bin, damit sie alle ihre Antworten bekommen!« Ich weiß nicht mehr, was er erwiderte. Sicher hatte er mit Leuten unter Schock mehr Erfahrung als ich.
Die Fahrt zum Krankenhaus
Dann kamen die Rettungssanitäter und wollten mich auf die Krankentrage legen. Ich schrie sie an, sie sollten mich in Ruhe lassen und sich um meine Kinder kümmern. Obwohl ich in meinem Herzen spürte, dass sie tot waren, wollte ich nicht wahrhaben, dass sich diese Ersthelfer auf mich konzentrierten. Es ging mir gut! Ich bin der Vater; ich bin hier, um meine Familie zu beschützen. Helfen Sie meinen Kindern, meiner Frau! Doch alle meine Worte konnten die tapferen Volontäre nicht davon abbringen, mich sanft zu überwältigen, mich am Nacken festzuschnallen und mich vorsichtig hochzuheben. Als sie mich zu dem wartenden Krankenwagen trugen, neigten sie die Trage an der Böschung unabsichtlich weit genug, dass ich mein Jackett über Calebs Gesicht liegen sah und einen Pullover über Abigails. Diese Symbolik aus den Kinofilmen schnürte mir die Luft ab. Was ich ahnte, bestätigte sich: Meine lieben Kinder waren tot.
Eine Welle unbeschreiblichen Grauens begann, mich unter sich zu begraben. Die Türen hinter mir schlossen sich. Jede Unebenheit der Straße erinnerte mich daran, dass ich mich nicht bewegen konnte. Ein ganz und gar ohnmächtiger Vater war ich! Ich war unbrauchbar. Trauer, Versagen, Schuld und Angst übermannten mich. Was konnte ich tun? Nichts!
Sie passten auf, dass ich in einer stabilen Lage blieb und lenkten bewusst ab, wenn ich nach meiner Frau und den Kindern fragte. Sie sagten: »Es wird sich um jeden gekümmert. Machen Sie sich keine Sorgen!«
Lügen.
Lügen, die natürlich helfen sollten. Aber sie halfen nicht. Ich gebe den mutigen, namenlosen Helfern keine Schuld. Ihre einzige Sorge in diesem Moment war es, mich bei Bewusstsein zu halten, bis ein Arzt bestätigen würde, dass mit mir tatsächlich alles in Ordnung war. Vielleicht lief ich ja mit einem Halswirbelbruch herum, der nur auf eine falsche Bewegung wartete? Nein, sie dachten jetzt nicht an meine Familie, die Person in ihrer Obhut war jetzt ich. Sie wollten vor allem meinen Körper retten, denn meiner Seele war offensichtlich nicht zu helfen, nachdem was ich gesehen hatte. Verbände, Arznei und Operationen kamen an meine tiefsten Verletzungen nicht heran.
In der Notaufnahme
Als wir in einem sehr kleinen Krankenhaus ankamen, wurde ich geröntgt und vom diensthabenden Arzt untersucht. Der Befund: Keine Gefahr! Mein Kopf und ein Fußgelenk schmerzten etwas, weil sie meine Drehpunkte im Auto gewesen waren, als es den Hügel hinabrollte. Doch beide sind robust, und es würde mir bald wieder gut gehen – körperlich.
Dann musste der Arzt etwas tun, was sicher kein Arzt gerne tut. Er hatte sein Leben der Rettung und nicht der Zerstörung von Leben gewidmet. Anscheinend durften die Krankenschwestern und Ersthelfer diese Aufgabe nicht übernehmen. Er hatte die tragische Verantwortung, mir zu sagen, dass für meinen kleinen Caleb und meine süße Abigail noch am Unfallort der Totenschein ausgestellt worden war. Leider würde ich sie nicht mit nach Hause nehmen können.
Nie mehr. Fast vernichtete mich die Endgültigkeit seiner Worte.
Meine Frau!
Was war mit meiner Frau? Ich schaute in das ruhige und traurige Gesicht des Arztes, der mich mit direktem Blick aufmerksam anschaute. Sie befand sich gerade jetzt im Rettungshubschrauber, nachdem man sie aus dem Auto befreit hatte. Das kleine Krankenhaus konnte ihr nicht helfen. Ihre einzige Hoffnung war die kilometerweit entfernte Unfallklinik in Madison. Wenn sie die Reise überlebte … Wenn war das winzige, aber mächtige Wörtchen, das ich allein hörte. Wenn sie überlebte, würde ich sie dort finden. Aber das Krankenhaus war mindestens eine Stunde entfernt!
Nun kam eine andere Person herein. Es war der Krankenhausseelsorger. Er war die Person, die versuchen würde, sich um meine tiefsten Verletzungen zu kümmern. Wir redeten ein wenig. Er gab sein Bestes. Aber ich war nun jenseits seiner Reichweite. Also betete er und tat damit alles, was ich brauchte.
Eine Krankenschwester half mir ein Telefon zu finden, und ich machte den ersten von einer ganzen Anzahl entsetzlicher Anrufe, welche die kommenden Stunden füllen würden. Irgendwie musste ich nach Madison kommen. Mit diesem Anruf bahnte sich das Grauen an jenem Nachmittag seinen Weg in das Leben unserer Freunde. Binnen 45 Minuten waren meine lieben Freunde Greg, Lesa und Debbie an meiner Seite und wir rasten nach Madison, um Penny einzuholen. Tränen, Umarmungen, Fassungslosigkeit und Schweigen füllten die Minuten.
Bangen um Penny
Als wir schließlich auf der Intensivstation ankamen, sagte man uns, Penny habe tatsächlich überlebt. Man wisse nicht, wie lang sie leben würde und ob oder wie sie weiterexistieren würde. Man wusste von einem unglaublichen Schädeltrauma. Beide Lungen seien kollabiert und es schien auch einige Knochenbrüche zu geben. Sie war an Schläuche angeschlossen, medikamentös eingestellt, aber dem Koma nahe. Wir mussten warten. Würde sie überleben oder leise an denselben Ruheplatz gleiten, an dem sich auch unsere lieben Kinder befanden. Ich schaute fassungslos und betäubt auf die übel zugerichtete Gestalt meiner Frau.
Was konnte ich tun? Was konnte ich sagen? Sie konnte mich ohnehin nicht hören. Sie würde vielleicht nie mehr etwas bemerken. Ihr zerschundener Leib barg nur das, was einst ihr Bewusstsein war. Vielleicht würde sie nie mehr daraus erwachen? Doch möglicherweise war es ein Segen. Denn dann würde sie nie erfahren, was geschehen war!
Alles hatte sich in nur wenigen Augenblicken verändert. Diese neue Wirklichkeit zehrte meine Welt immer weiter auf. Was aus meinem Leben nach diesem Tag auch werden würde, es würde auf jeden Fall nie mehr dasselbe sein.
Wie Stunden kam es mir vor, als ich so dastand und meine Frau anstarrte. Ihr Gesicht war schon fast unkenntlich. Die Schwellung hatte ihre Gesichtszüge entstellt und es in eine große überdimensionale Masse verwandelt. Ihr Haar war verfilzt und entfärbt und voller Glassplitter und anderer Trümmer. Man hatte sie bis jetzt nicht gesäubert, sondern sie erst mal versucht zu stabilisieren. Die Schläuche und das Piepsen der Atmungsgeräte steigerten nur noch die surreale Atmosphäre. Keine Bewegung. Technisch gesehen war sie am Leben. Doch dies war offensichtlich kein Leben. Ernüchterung, Gebet, Fragen, Hoffnungslosigkeit, Glaube, alles schien zu kollidieren und sich zu einem wirbelnden Kräftestrudel zu verbinden, den ich nicht mehr im Griff hatte und der dazu führte, dass alles in Scherben lag, was ich über mich selbst je gedacht hatte.
Was würde geschehen, wenn meine Frau sterben würde? Ich war schon Zeuge vom Tod meiner beiden Kinder geworden. Musste ich nun zusehen, wie das Leben auch aus meiner Frau gesaugt würde? Wie wäre es, ohne Familie zu leben? Wo war Gott jetzt? Wie konnte ein guter Gott so viel Schmerz zulassen? Habe ich an eine Lüge geglaubt? War mein Glaubenszeugnis in der Gemeinde nur wenige Stunden zuvor nur eine Sammlung netter Geschichten und jahrhundertealter Bibelverse, die in den dunkelsten Stunden, wo man sie am meisten brauchte, dann doch versagten?
Ich war allein im Zimmer und mit meinen Gedanken. Nur die unmittelbaren Angehörigen durften zu mir; und von ihnen war keiner da. Ich erfuhr später, dass mein Bruder und meine Großeltern die ganze Nacht durchfahren würden, um so schnell wie möglich anzukommen. Meine Eltern waren in Alaska und versuchten fieberhaft, den ersten Flug ins Kernland der USA zu bekommen. Pennys Mutter tat verzweifelt ihr Bestes, um so schnell wie möglich an die Seite ihrer Tochter zu gelangen. Aber ich würde sie frühestens am nächsten Tag sehen.
Tröstende Freunde
An ihre Stelle trat unsere örtliche »Familie«. Über dreißig unserer Freunde weinten und beteten im Wartezimmer und fragten sich, was aus mir und Penny werden würde. Würde Penny die Nacht überleben? Was würde aus mir werden ohne meine Kinder und möglicherweise auch ohne meine Frau?
Dann kam eine Krankenschwester und sprach in den Sturm meiner Gedanken hinein. Sie müsse mir etwas Wichtiges sagen. Ob ich bitte aus Pennys Zimmer herauskommen könne zu meinen wartenden Freunden? Sie versicherte mir mehrfach, dass ich nichts tun könne; alles, was man für Penny tun konnte, werde bereits für sie getan. Als ich mich zum Gehen wandte, musste ich der Wirklichkeit wieder ins Auge sehen: Ich war völlig unbrauchbar.
Beim Hinausgehen tobte der Sturm der Gefühle stärker, weil ich mich auch noch als nutzlos, ja untreu verurteilte. Was für ein Mann war ich? Wäre es nicht besser gewesen, ich wäre auch gestorben? Wo war mein Gott jetzt?
Dort in der Gegenwart der Freunde, die mich zum Krankenhaus gebracht hatten und anderer, die zu ihnen gestoßen waren, schaute mir die Schwester direkt in die Augen und sagte, dass ich Schlaf brauche. Sie sagte mir, es gebe nichts, was ich tun könne. Ich müsse mich jetzt um mich selbst kümmern. Sie machte sich nicht nur um Penny Sorgen, sondern auch um mich. Nach einem Tag würde ich wahrscheinlich sehr starke körperliche Schmerzen bekommen von dem Stress und der körperlichen Belastung, die ich durchgemacht hatte, ganz zu schweigen von dem mentalen Aufruhr. Sie befahl mir daher zu schlafen und meine lieben Freunde machten einen Plan, damit ich in dieser ersten höllischen Nacht nicht allein sein würde.
Greg erklärte sich sofort bereit und sagte, er würde nicht von meiner Seite weichen und so lange bei mir bleiben, wie er gebraucht würde. Ich brach fast in seinen Armen zusammen. Die Tränenflut brach sich Bahn und ich schluchzte hemmungslos. Meine Freunde umringten mich, hielten mich fest und ließen auch ihren Tränen freien Lauf. In ihren stützenden Armen verdrängte ihre vereinte Liebe und Zuversicht die Hoffnungslosigkeit für eine Weile. Doch in ihren Augen sah ich die Angst hinter ihren Tränen lauern. Wie ein ungebetener Gast im Raum unterbrach sie alle mit derselben Frage: Bedeutet diese Nacht den Tod meiner Familie oder auch meines Glaubens an einen guten Gott?
Schließlich zog mich Greg mit sich. Wir gingen in ein Gästezimmer in der Nähe und ich wurde mithilfe von Medikamenten von einem unruhigen Schlaf übermannt.
Fortsetzung Teil 1 der Serie In Englisch
Quelle: Bryan C. Gallant, Undeniable, An Epic Journey Through Pain, 2015, Seite 35-41

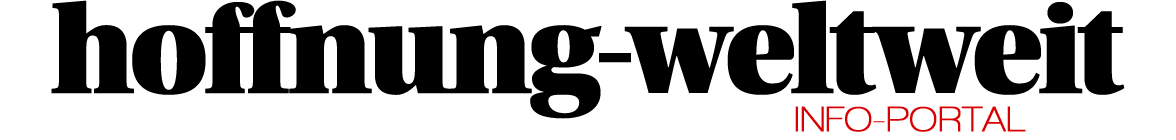

Schreibe einen Kommentar