Du meinst es gut, erreichst aber nichts. Im Gegenteil, du wirst auch noch verdächtigt? Dann brauchst du die Heilung, die der Autor dieser Artikelserie erlebt hat. Von Bryan Gallant
»Der Tod ist nicht der größte Verlust im Leben. Der größte Verlust ist, was in uns stirbt, während wir leben.« Norman Cousins
Allein im Kaufhaus
Eines Tages schlenderte ich durch den Walmart und befand mich gerade zufällig in einem großen Gang zwischen zwei Abteilungen. Ich schaute mich um, beobachtete die Leute und ging einfach aufmerksam durch die Einkaufswelt. Ich erinnere mich nicht mehr, ob ich ein bestimmtes Ziel oder gar einen Einkaufszettel hatte. Auch weiß ich nicht mehr, wo Penny gerade war. Vielleicht hatte sie gerade einen der regelmäßigen Nachuntersuchungen bei den Ärzten, die sich darum bemühten, ihre Lungenkapazität wieder auf Vordermann zu bringen. Oder sie hatte Krankengymnastik, um die Beweglichkeit ihrer angeschlagenen Schulter zu steigern, während sie lernte, sich damit abzufinden, dass sie ihre linke Hand nicht mehr einsetzen konnte und sie mit dieser Behinderung leben musste.
Ich erinnere mich nicht warum, aber ich war einfach in diesem Kaufhaus und ich war dort allein; sehr allein, wie sich herausstellte, nur meine Gedanken konnten mich trösten und begleiten, was sie aber nicht taten.
Jeder Schritt führte mich durch neue Gänge und an neuen Käufern vorbei. Ich schaute die Leute an, die einen Grund dafür hatten, hier zu sein, Menschen, deren Leben noch lebenswert war. Meine Schritte wurden langsamer, meine Gedanken tiefgründiger.
Seit unserem Schicksalstag im Dezember wurde uns allmählich immer bewusster, wie sehr unser Leben sich verändert hatte. Es würde aber Monate dauern, bis wir erkannten, was wir mit dem Tod unserer Kinder in einem Augenblick verloren hatten.
Unsere neue Identität
Man denke nur! Vorher waren wir eine vierköpfige Familie mit Autositzen und Wickeltaschen, immer mit einem Auge auf unsere Kinder. Die Leute behandelten uns wie eine wachsende Familie. Dann waren die Kinder plötzlich weg.
Alle weg.
Unser Ersatzwagen war fast leer, das Wegfahren viel leichter. Keine extra Taschen, keine verspuckten Klamotten. Nur wir beide!
Mit 26 Jahren waren wir schon fünf Jahre verheiratet, hatten zwei Kinder bekommen und zwei Kinder beerdigt! Die Leute hielten uns nun für ein junges kinderloses Paar und hatten überhaupt keine Ahnung, wer wir waren. Die meisten unserer Freunde hatten Kinder, aber jetzt waren wir traumatisierte Außenseiter, die versuchten ihren neuen Platz zu finden. Durch jenen tragischen Tag war unsere ganze gesellschaftliche Identität auf Null gesetzt und wie weggewischt worden.
Selbst so eine einfache Sache wie Einkaufen veränderte sich in unserem Leben. Wir hatten nun keine langen Listen mehr mit dem ganzen Zubehör, das Eltern für ihre Kinder einkaufen. Wir hatten kein Verlangen nach Windeln oder Wischtüchern mehr oder süßen Kleidern, die gerade im Angebot waren. Nein, uns fehlte auch die Begeisterung, wenn wir etwas Kleines fanden, das normalerweise einen freudigen Aufschrei oder leuchtende Augen ausgelöst hätte. Alles war anders.
Wir brauchten auch nicht mehr viele Lebensmittel. Nur noch selten aßen wir daheim, da unser Tisch sich in ein lebendiges Mahnmal verwandelt hatte. Dort herrschte das Schweigen des Todes: kein Gezanke ums Essen, kein Kindergeplapper, und zwei Seiten des Tisches waren immer leer! Auf den verbleibenden zwei Stühlen saßen zwei gebrochene Personen, die aßen, weil sie essen mussten, nicht weil sie essen wollten. Ohne Ziel und Freude war also auch das Einkaufen zu einem bloßen Vorgang abgesunken.
Und als Vorgang war es manchmal einfach deshalb heilsam, weil es einen aus seinem Zuhause herausholte – nein, es war kein Zuhause, es war nur ein Haus. Unser Zuhause war nicht mehr. Um einem Haus zu entkommen, wo alles still war und uns ausschließlich an unser leeres Leben erinnerte, gingen wir einkaufen. Das Einkaufen war eine Ablenkung. Es kam einem Tapetenwechsel gleich. Wir suchten etwas in den Angeboten, was unsere Gebrochenheit vielleicht hätte lindern können.
Doch auch das funktionierte nicht. Nichts half sehr lange. Was man mit Geld kaufen kann, ist kein Ersatz für unsere Lieben. Es konnte unser altes Leben nicht zurückholen. Wenn wir etwas füreinander kauften, erlebten wir zwar kurze Glücksmomente und verstohlenes Lachen, aber eben nur kurzzeitig. Wir trugen Schuldgefühle mit uns herum, weil wir immer noch am Leben waren. Unser Lachen empfanden wir als Respektlosigkeit unseren Kindern gegenüber. Jedem kurzzeitigen Gefühl der Freude folgte Bedauern, Traurigkeit und der Eindruck, ein Verräter zu sein.
Überlebende tragen das täuschende Gefühl mit sich herum, sie hätten sich schuldig gemacht und dem Verstorbenen ihre Kameradschaft aufgekündigt. Wie konnten wir auch nur flüchtiges Glück zum Ausdruck bringen, wenn sie nicht dabei waren! Das Einkaufen war nun etwas ganz Anderes. Es erinnerte uns an unser traumatisches Leben, an unseren Weg durchs Todestal.
Verfolgte im Restaurant
Auch der Besuch im Restaurant war es ein neues Erlebnis. Da unser Tisch zu Hause ein Ort der Qual war, aßen wir regelmäßig auswärts. Doch auch dort gerieten wir immer wieder in einen Hinterhalt.
Wir betraten das Restaurant, um uns zu ernähren und uns wieder einmal von unserer Leere abzulenken. Doch da gab es andere Familien. Jeder Vierertisch, jeder Hochstuhl, jede Lerntasse stach uns ins Auge, ja schrie uns an. Aber es waren nicht nur diese sichtbaren Symbole. Unsere Ohren hörten sofort die Kinder aller Besucher im ganzen Raum. Nicht unsere, sondern ihre!
Elternohren sind erstaunlich spitz und lassen sich nicht abschalten, wenn die Kinder keinen Lärm mehr machen. Akustischen Attacken gleich quälten uns die Geräusche der Kinder. Ihr unschuldiges Lachen schien uns wie Hohn und Spott. Jeder Ruf nach Mama oder Papa traf uns wie ein Messerstich. Die wiederholten Rufe, die endlich Mamas oder Papas Aufmerksamkeit erlangen wollten, waren für uns wie chinesische Wasserfolter: Langsam aber sicher raubten sie uns den Verstand.
Wie gern hätten wir die Eltern geschüttelt und ihnen gesagt, dass sie doch jeden Augenblick auskosten möchten. Aber sie hätten den schmerzerfüllten Blick in unseren Augen nicht verstanden. Wir wussten, dass unsere Kinder tot waren, wir zuckten jedoch immer noch bei jedem Wimmern zusammen voller Sehnsucht, Fürsorge zu schenken. Atemlos hatten wir in der Kinderzimmertür gestanden und auf den leisesten Hinweis gehorcht, dass sich ihre Brust hob und senkte. Jetzt trieb die verblassende Erinnerung daran mit uns ihr Spiel, wenn wir das Kind einer anderen Frau friedlich in ihren Armen schlafen sahen. Deprimiert ließen wir die Arme hängen, um eine weitere Erinnerung loszulassen.
Es gab Zeiten, wo wir es einfach nicht mehr ertrugen und uns zum Gehen anschickten. Dann prasselte das Stimmengewirr nur noch auf unsere Hinterköpfe, wir stammelten eine faule Ausrede für unser vorzeitiges Gehen und verließen den Raum. Der Versuch einer ausführlicheren Erklärung wäre ohnehin nur mit leeren Blicken und unbeholfenen Worten quittiert worden. Wir zogen uns also in die unfreiwillige Stille unseres Autos zurück und weinten. Schließlich meldete sich der Hunger wieder und ein Drive-in spendete Trost in der Einsamkeit unseres Leides. Das sind ein paar Beispiele dafür, wie sich unsere Welt verändert hatte.
Vom Held zum Totalversager
Als ich so durch den Walmart schlenderte, dachte ich darüber nach. Ich wälzte mich in meiner Leere und verspürte die paradoxe Einsamkeit, die traumatisierte Menschen erleben: umgeben von vielen, sind sie doch ganz allein! In Gedanken versunken, war ich nicht vorbereitet, auf das, was ich gleich erleben würde. Wie ein ausgebildeter Menschenmörder, der nur auf den richtigen Moment wartet und auch nur einmal zuschlagen muss, sollte eine der tiefsten Wunden vom Unfall wieder aufbrechen und sich auf mich stürzen. Es war der Schmerz, den kein Röntgengerät entdecken und keine Medizin lindern kann.
Als ich in einen Gang einbog, sah ich, wie ein Kind in seinem Einkaufswagen aufstand. Nicht in dem großen Korb, wo es einigermaßen ungefährlich wäre, nein, in dem Kindersitz mit den Gurten. Das Mädchen saß nicht. Sie stand, bewegte sich hin und her und rief ihre Eltern, die ich nicht sehen konnte. Sie beugte sich über und rief. Aber es war niemand zu sehen.
Sofort packte mich ein unerklärliches Grauen. Wie in einem Flashback sah ich mein eigenes Kind herunterfallen und sich verletzen. Furcht und Dunkelheit umgaben mich und ich spürte wie die Ohnmacht mit kreischenden Bremsen auf mich zuraste. Ich sah vor mir wieder nur Schmerz und Tod, doch was konnte ich tun? Zum Helfen war ich zu weit weg. Eine Fehleinschätzung oder ein Stoß, und das Kind würde kopfüber auf den Betonfußboden fallen und sich schwer verletzen. Meine Vernunft begann angesichts solcher Gefühle zu weichen. Ich durfte nicht wieder versagen! Ich musste »mein« Kind retten!
Sein Gesicht war jetzt verschwommen, denn ich wusste nicht mehr, ob ich die Realität vor Augen hatte oder nur einen realistischen Flashback erlebte. Ich ging auf das Kind zu. Damit es sich nicht erschrak, rannte ich nicht. Dennoch ging ich zielgerichtet und schnell. Verzweifelt schaute ich mich nach den Eltern um, aber ich konnte sie nicht sehen. Wer lässt denn bei vollem Verstand sein Kind so etwas tun? Sehen sie nicht, wie schnell sich alles ändern kann? Entrüstung und Zorn stiegen in mir auf.
Keine Eltern! Wo waren sie?
Ich war allein in Sichtweite dieser latenten Katastrophe. Immer näher kam ich, bis ich schließlich in Reichweite war. Sollte das Kind stürzen, könnte ich wenigstens mit einem Sprung seinen Kopf auffangen, bevor er auf dem unerbittlichen Betonfußboden bersten würde. Es war mir egal, was für Schmerzen mich das Szenario kostete. Ich durfte nicht versagen. Gewiss stand mir die ganze Intensität und Entschlossenheit ins Gesicht geschrieben.
Genau in diesem Moment tauchte die Mutter wie aus dem Nichts auf und überblickte die Situation. Mein Gesicht. Meine Konzentration. Meine unmittelbare Näher zu ihrem Kind! Wenn Blicke töten könnten! Bis heute ertrage ich die Erinnerung an diesen Blick nicht. Alles, was sie sehen konnte, war jemand, dessen Nähe gefährlich für ihr Kind war! Vielleicht ein Perverser oder ein Kinderschänder, der ihrem unschuldigen Schatz auflauerte, der sich paradoxerweise Walmart als Tatort ausgesucht hatte, um sich mit ihrem Kind davonzuschleichen und als Portrait mit dem Kind auf dem Arm auf dem Plakat für vermisste Kinder zu erscheinen! Da stand ich also, nah genug, um ihr liebes Kind zu erreichen!
Ja, ihr stechender, scharfer Blick war gerechtfertigt. Vom Kopf her verstand ich sie, aber sie konnte mir nicht ins Herz schauen. Sie kannte den Sturm nicht, der in mir tobte, der gute Wille, der mich trieb. Nein, ich wollte keinen Schmerz verursachen, sondern Hilfe leisten. Aber das konnte sie nicht sehen. Ihr Blick sprach Bände. Wie eine Bärenmutter mit Nachwuchs starrte sie mich an, damit ich zurückwich.
Natürlich tat ich das auch.
Ich war nicht nur unfähig, Hilfe zu leisten, man hatte mich auch noch in die unterste soziale Schublade gesteckt, obwohl ich nur versucht hatte, Gutes zu tun. Die Urteile und die Blicke der Menschenmenge, die ich mir vorstellte, schienen mich zu umzingeln. Schuld, Verzweiflung, Wertlosigkeit, Bosheit, Ohnmacht, Außenseiter, Ekel – jedes Wort, jedes Gefühl wurde lebendig, trat nach mir und trieb mich fort. Wie ein Held, der herbeieilt, um einen Gefangenen vor dem herannahenden Zug zu retten, nur um zu sehen, wie der Gefangene im letzten Moment weggerissen wird und der Held als Täter der heimtückischen Tat gebrandmarkt, an seiner Stelle gebunden und vernichtet wird, die Schande trägt, den Schmerz und schließlich den Tod. Ich humpelte davon, vermied es, gesehen zu werden, und hoffte, die Sicherheitsleute würden mich nicht ansprechen.
Was für ein Totalversager war ich doch!
Fortsetzung Teil 1 der Serie In Englisch
Aus: Bryan C. Gallant, Undeniable, An Epic Journey Through Pain, 2015, Seite 69-75

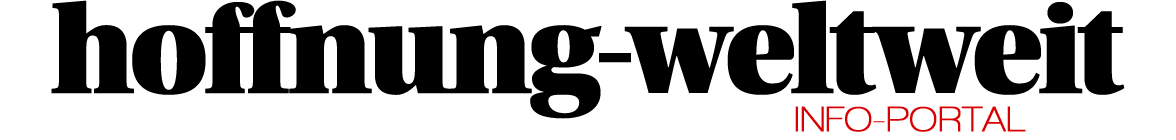

Schreibe einen Kommentar