Eine Prophezeiung, die Mut macht für die Bergtour unseres Lebens. An welcher Station befinde ich mich? Von Ellen White
Als ich im August 1868 in Battle Creek, Michigan war, träumte ich, dass ich mich in einer großen Menschengruppe befand. Ein Teil dieser Gesellschaft war reisefertig und zog los. Wir reisten mit schwer beladenen Wagen. Unser Weg führte bergauf. Auf der einen Seite der Straße war ein tiefer Abgrund, auf der anderen Seite eine hohe, glatte, weiße Wand, die wie frisch verputzt und gestrichen wirkte.
Als wir weiterfuhren, wurde die Straße immer schmaler und steiler. An manchen Stellen schien sie so schmal, dass es keinen Sinn mehr machte, mit beladenen Wagen weiterzufahren. Daher schirrten wir die Pferde ab, luden einen Teil des Gepäcks von den Wagen auf die Pferde um und setzten unseren Weg auf dem Pferderücken fort.
Bald jedoch wurde der Weg immer enger. So waren wir gezwungen, dicht an der Wand zu reiten, um nicht von der schmalen Straße in den Abgrund zu stürzen. Doch die Pferde stießen mit dem Gepäck immer wieder gegen die Wand, sodass wir gefährlich über dem Abgrund ins Schwanken gerieten. Wir hatten Angst hinunterzufallen und an den Felsen zu zerschellen. Also kappten wir die Stricke, mit denen das Gepäck auf den Pferden befestigt war, und ließen es in den Abgrund stürzen. Als wir weiter ritten, fürchteten wir, an den engeren Wegstellen, unser Gleichgewicht zu verlieren und zu fallen. Da schien es, als würde eine unsichtbare Hand die Zügel ergreifen und uns über die gefährlichen Passagen führen.
Doch dann wurde der Weg noch enger. Nun war es uns nicht mehr sicher genug auf den Pferden. Daher stiegen wir ab und gingen zu Fuß hintereinander, einer folgte den Schritten des anderen. Jetzt wurden dünne Seile vom oberen Ende der sauberen weißen Wand heruntergelassen; erleichtert packten wir zu, damit wir besser balancieren konnten. Mit jedem Schritt bewegten sich die Seile mit. Schließlich wurde der Pfad so eng, dass wir es sicherer fanden, den Weg ohne Schuhe fortzusetzen. Also zogen wir sie aus und gingen ein Stück auf Socken. Bald beschlossen wir, dass wir ohne Socken noch besseren Halt hätten; also zogen wir auch die Socken aus und gingen barfuß weiter.
Da mussten wir an jene denken, die Entbehrung und Not nicht gewöhnt waren. Wo waren sie jetzt? Sie waren nicht in der Gruppe. An jeder Station waren einige zurückgeblieben, und nur die gingen weiter, die Not gewöhnt waren. Die Entbehrungen des Weges machten sie nur umso entschlossener, bis ans Ende durchzuhalten.
Die Gefahr, vom Weg abzukommen, wurde immer größer. Auch wenn wir uns ganz nah an die weiße Wand drückten, war der Pfad trotzdem schmaler als unsere Füße. Wir verlagerten unser ganzes Gewicht auf die Seile und riefen erstaunt: »Wir haben von oben Halt! Wir haben von oben Halt!« Diesen Ausruf hörte man überall in der Gruppe auf dem schmalen Weg. Als wir den Freudenlärm und das Treiben aus dem Abgrund hörten, schauderten wir. Wir hörten lästerliche Flüche, anzügliche Scherze und ordinäre, widerwärtige Musik. Wir hörten Kriegs- und Tanzlieder, Instrumentalmusik und lautes Gelächter, dazwischen Verwünschungen, Schmerzensschreie und bittere Wehklagen. Da waren wir entschlossener denn je, auf dem schmalen, beschwerlichen Pfad zu bleiben. Die meiste Zeit waren wir gezwungen, unser ganzes Gewicht in die Seile zu hängen, die mit jedem Schritt größer und dicker wurden.
Jetzt bemerkte ich, dass die schöne weiße Wand mit Blut befleckt war. Die Wand so beschmutzt zu sehen, machte mich traurig. Dieses Gefühl wich jedoch bald der Erkenntnis, dass wohl alles so seine Richtigkeit haben müsse. Die Nachfolgenden sehen daran, dass andere den schmalen, beschwerlichen Weg schon vor ihnen gegangen sind, und wenn andere den Weg gegangen sind, konnten sie es folglich auch schaffen. Wenn ihre schmerzenden Füße ebenfalls zu bluten anfingen, würden sie nicht entmutigt aufgeben, sondern das Blut an der Wand sehen und wissen, dass andere die gleichen Schmerzen ertragen hatten. Schließlich kamen wir an einen riesigen Abgrund. Hier endete unser Weg.
Jetzt gab es nichts mehr, woran wir uns orientieren oder worauf wir unseren Fuß setzen konnten. Wir mussten uns ganz auf die Seile verlassen, die nun schon so dick waren wie wir selbst. Eine Zeit lang waren wir verwirrt und besorgt. Wir fragten ängstlich flüsternd: »Woran ist das Seil befestigt?« Mein Mann stand direkt vor mir. Der Schweiß tropfte ihm nur so von der Stirn, seine Hals- und Schläfenadern waren zu doppelter Größe angeschwollen und ein verhaltenes, qualvolles Stöhnen kam über seine Lippen. Auch von meiner Stirn tropfte der Schweiß, und ich empfand eine Angst wie nie zuvor. Ein furchtbarer Kampf lag vor uns. Sollten wir hier versagen, hätten wir all die Schwierigkeiten unserer Reise umsonst durchgemacht.
Vor uns, auf der andern Seite des Abgrunds, lag eine schöne Wiese mit grünem, etwa fünfzehn Zentimeter hohem Gras. Obwohl ich die Sonne nicht sah, war die Wiese in ein helles, sanftes Licht aus purem Gold und Silber getaucht. Nichts, was ich auf Erden je gesehen habe, ist vergleichbar schön und herrlich gewesen. Doch konnten wir sie erreichen? So war unsere ängstliche Frage. Sollte das Seil reißen, würden wir umkommen. Wieder fragten wir im Flüsterton: »Woran ist das Seil denn befestigt?« Einen Augenblick zögerten wir. Dann riefen wir: »Es bleibt uns einfach nichts anderes, als uns komplett auf das Seil zu verlassen. Den ganzen beschwerlichen Weg haben wir uns ja an ihm festgehalten. Dann wird es uns wohl auch jetzt nicht im Stich lassen.« Dennoch zögerten wir verzweifelt. Da sagte jemand: »Gott hält das Seil. Wir brauchen keine Angst zu haben.« Die hinter uns wiederholten diese Worte, und jemand fügte hinzu: »Er wird uns jetzt nicht im Stich lassen. Schließlich hat er uns auch sicher bis hierher gebracht.«
Daraufhin schwang sich mein Mann über den furchtbaren Abgrund auf die schöne Wiese auf der anderen Seite. Ich folgte ihm sofort. Wie erleichtert und Gott dankbar waren wir nun! Ich hörte Stimmen, die in triumphierendem Dank zu Gott aufstiegen. Ich war glücklich, vollkommen glücklich.
Als ich aufwachte, merkte ich, dass ich noch am ganzen Körper zitterte von der Angst, die ich auf dem schwierigen Weg durchlebt hatte. Dieser Traum bedarf keines Kommentars. Er beeindruckte mich so stark, dass ich mich mein Leben lang an jede Einzelheit erinnern werde.
Aus: Ellen White, Testimonies for the Church, Mountain View, Cal.: Pacific Press Publishing Co. (1872), Bd. 2, S. 594-597; vgl. Leben und Wirken, Königsfeld: Edelstein-Verlag (o. J.) 180-182.
Erstmals von hoffnung weltweit veröffentlicht in: Unser festes Fundament, 6-2002.

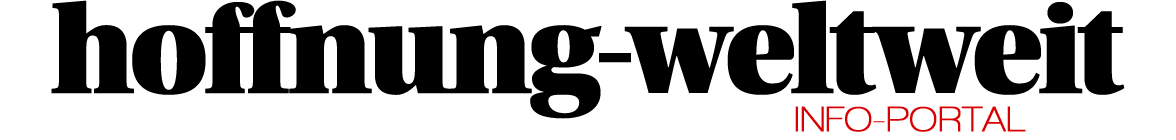

Schreibe einen Kommentar