Stiller Widerstand und Abschied. Von Gerhard Bodem
Rückblick Teil 1: Ich wurde 1931 auf einem Bauernhof in Ostpreußen geboren. Um dem Wehrsport im Grenzgebiet zu entkommen, zog mein Vater mit uns 1934 nach Pommern, wo zwei Jahre später meine Mutter verstarb. Als ich an Lungentuberkulose erkrankte, gaben mich die Ärzte auf.
Unter dem Segen des »großen Arztes« und der guten Versorgung mit eigenen Erzeugnissen auf dem Land erholte ich mich, völlig entgegen der Erwartung der Ärzte, von meiner Lungentuberkulose. Ich sollte dem Tod noch einmal von der Schippe springen. Damals kam von Zeit zu Zeit eine Diakonissenschwester zu uns. Ihren Namen haben wir leider vergessen, nicht aber ihren tröstenden Zuspruch und ihre Taten selbstloser Liebe. Wie wohltuend war dieses praktisch gelebte Christentum in jener schweren Zeit.
Märtyrer Hanselmann
Unvergessen bleibt auch der Dienst unseres Predigers Johann Hanselmann. Er fand eine Anstellung als Vertreter einer Baumschule. Es war ein besonderes Gnadengeschenk, dass er mit dem Firmenwagen nicht nur seine Aufträge ausführen konnte; er diente auch den Geschwistern in den verschiedenen Orten. So sprach er ermutigend über unsere Glaubenshoffnung bei der Beerdigung unserer Mutter. Etwa zwei Jahre lang konnte er seiner zerstreuten Herde als ein treuer Hirte Jesu Christi dienen. Er reichte den Geschwistern das »Brot des Lebens« und das Heilige Mahl und stärkte sie im Glauben, dass wir »durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen« (Apostelgeschichte 14,22).
Da unsere Glaubensgemeinschaft durch Verfügung des stellvertretenden Chefs der Geheimen Staatspolizei für das gesamte Reichsgebiet aufgelöst und verboten worden war, wurde er eines Tages verhaftet und mehrmals verhört. Seine Verteidigung war das Wort in Apostelgeschichte 5,29: »Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.« Nach einer zweijährigen Haftstrafe sollte es noch schlimmer werden. Er kam in das Konzentrationslager Sachsenhausen. Ein Glaubensbruder und Mithäftling berichtete später, dass Bruder Hanselmann trotz Folterungen dem HERRN treu blieb bis in den Tod.
Papa hatte eine Geldstrafe zahlen müssen, nur weil er unseren Bruder um den Dienst am Grabe unserer Mama gebeten hatte. Fortan kam oft Besuch von der Ortspolizei. Es kamen jeweils zwei Mann hoch zu Ross, und wir Kinder versteckten uns. Mit der Zeit lernten diese Staatsdiener uns kennen und merkten, dass wir weder Kriminelle noch staatsgefährdende Leute waren. Einer von ihnen zeigte sogar Interesse an den biblischen Prophezeiungen für die Endzeit.
Oma und Opa kommen
In dieser Notlage zogen Opa und Oma Bodem vom Erlental in Ostpreußen zu uns nach Pommern und halfen uns finanziell. Oma war eine tüchtige Pilzsammlerin. Mit den Taschen voller Pfifferlingen und im Juli auch mit Blaubeeren fuhr sie oft in die Stadt und verkaufte die Pilze und Beeren. Opa betätigte sich als Bienenzüchter.
Auf die Dauer wurde es in unserem Haus zu eng. Deshalb zogen die Großeltern ein Stückchen weiter an den Ortsrand zu einer Familie Theil. Gleich hinter dem Grundstück begann der auch für uns Kinder interessante Wald.
Familienzuwachs: Martha Fischer
Im Sommer 1937 kam die Glaubensschwester Martha Fischer aus Mallnow zur Erntehilfe. Sie war Feldarbeit gewöhnt und half beinahe unermüdlich. Auch sie war eine Leidensgenossin und erzählte von ihrer Haftstrafe um des Glaubens willen an DEN, der wie wir einst zum »Stein des Anstoßes« geworden war. Hitler hatte erklärt: »Ich schaffe das Dogma der Erlösung der Menschheit durch das Leiden und den Tod eines göttlichen Heilands ab und schlage die Erlösung des Individuums durch das Leben und die Taten des neuen Führers und Gesetzgebers vor …«
Martha hatte aber den Deutschen Gruß abgelehnt mit dem Hinweis auf das Wort: »In keinem andern ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden.« (Apostelgeschichte 4,12)
Nach einiger Zeit fragten wir uns, ob der Heiland uns die Tante Martha gesandt hatte? Papa jedenfalls sah es so und so wurde aus der Tante unsere zweite Mutter. Das ging nicht so einfach und schnell, wie es sich hier liest, aber sie willigte ein, bei uns zu bleiben.
Es gab keine große Hochzeitsfeier. Es war einfach alles ein Zubereitungs- und Bewährungsprozess. Fleiß und Ausdauer waren gefragt. Und darin war die zweite Frau dem Papa eine kräftige Stütze. Bei der Feldarbeit kam kaum einer mit ihr mit.
Unsere neue Mutter erwartete allerdings auch von uns vollen Einsatz. Doch wir Kinder waren ja noch klein und zu schwach für diese harte Gangart. Wir fühlten uns mitunter überfordert, ja auch ungerecht behandelt. Mein kleines Schwesterlein litt sehr darunter und manchmal trafen wir uns in der Scheune oder im Stall, um uns auszutauschen und auszuweinen. Jahre später bekannte uns Mutter Martha, dass sie uns zu hart behandelt hatte und es ihr an Einfühlungsvermögen gemangelt hätte. Es war dann an uns zu vergeben und zu vergessen.
Einkaufen mit Pferd und Wagen
Über die Weltereignisse erfuhren wir wenig. Hin und wieder war eine Fahrt in unsere Einkaufsstadt Gollnow (heute: Goleniów) notwendig. Welche Freude, wenn wir alle mitfahren durften. Bei Willi Daberkow konnten wir Pferd und Wagen lassen, den Wunschzettel im großen Laden abgeben und in der Stadt weitere Besorgungen machen.
Einmal brachte Papa einige gebrauchte Einrichtungsgegenstände mit. Er hatte sie einer jüdischen Familie abgekauft, um mitzuhelfen das Fahrgeld zusammenzubekommen für die Auswanderung. Die Leute in der Stadt befürchteten den baldigen Kriegsausbruch.

Der Krieg beginnt
Kurz vor Kriegsbeginn hatte Papa einen Sanitätskursus besucht und am 1. September 1939 wurde er einberufen. Aber nach nur vier Tagen entließ man ihn als »überzählig«. Darüber war unser aller Freude groß.
Landidylle
Jeder hatte ja seine festen Aufgaben. Urlaub konnten wir uns nicht leisten. Wir Kinder hatten Katze, Hund, Hühner und Küken zu versorgen. Konservendosen gab es keine. Alles musste von Hand zubereitet werden. Die Schule war eine willkommene Abwechslung. Kaum zu Hause, hieß es: »Ranzen runter und Kühe hüten!« Solange sich die kräftigen Tiere mit dem Gras auf den Feldwegen begnügten, ging alles gut. Aber die Feldfrüchte rechts und links des Weges lockten sehr. Wenn sie dann noch von Fliegen geplagt wurden, konnten wir sie nicht mehr an der Kette halten. Eine Kuh trabte in das duftende Süßlupinenfeld und fraß sich so voll, dass sie hernach kaum durch die Stalltüre passte. Wir nannten sie »dicker Klops«.
Im Sommer kamen die Eltern oft spät vom Feld nach Hause. Einmal wagten wir es, uns für den harten Einsatz selbst zu belohnen. Wir überlegten: Was essen wir gern? Pfannkuchen! Wir machten sie recht süß und sparten auch nicht mit Eiern. Wir ließen uns die Kuchen schmecken und sagten den Eltern nichts davon. Erst viel später berichteten wir ihnen von unserer »Heldentat«!
Im Glauben liegt Kraft
Willkommene Abwechslung gab es jeweils am Sabbat. Unsere »Versammlung« bestand aus der vierköpfigen Familie, ab und zu auch noch mit Oma und Opa. Wir lasen die Bibel und Christi Gleichnisse oder In den Fußspuren des großen Arztes, wobei wir Kinder gern die Bilder anschauten. Wenn ich mich nicht irre, waren wir nur einmal in Stettin zum Gottesdienst in der Adventkapelle. Am Sabbatmittag gab es oft etwas Besonderes zum Nachtisch, auch wenn es nur ein schöner großer Apfel war. Nachmittags folgten Spaziergänge in die Felder oder in den Wald.

Interessant war auch die »Burower Mühle« mit den Beerengärten. Sie »ruhte« schon lange, aber immer wieder bestaunten wir den See und das große Mühlenrad. Im Wald oder am Ufer des Sees las Mama uns dann aus Lebensbilder vor. Im Winter saß ich abends gern mit meiner Schwester Hanna auf der Ofenbank, bis das Abendessen fertig war. Wir lernten auswendig und sangen nacheinander alle Kinderlieder durch: »Weil ich Jesu Schäflein bin«, »Wenn der Heiland als König erscheint« und andere.
Die letzten Kriegsjahre
Im Januar 1943 wurde Papa ein zweites Mal eingezogen. Diesmal war er fünf Wochen in Neustrelitz. In der Zeit hatte Mama infolge einer Blutvergiftung durch einen Fremdkörper den Mittelfinger der rechten Hand verloren. Mit dieser Behinderung begründete sie einen Unabkömmlichkeitsantrag, der auch angenommen wurde, was zu Vaters Entlassung führte.
Die Schullehrer waren fast alle beim Militär. Wir hatten ab Herbst 1944 jeweils nur noch drei Tage Schulunterricht pro Woche. Man kann sagen, dass für uns die letzten beiden Kriegsjahre Gnadenjahre waren. Wir erhielten eine junge Polin zur Hilfe. Auch mit Hilfe von Maschinen ging manches leichter als zuvor. Hungern brauchten wir nicht. Unsere Kühe lieferten reichlich gute Milch. Unsere Hühnerschar legte so viele Eier, dass wir Not leidenden Verwandten helfen konnten. Ob es Tante Lieschen aus Berlin war oder Onkel Sabarowski aus Stettin, sie konnten zu jedem Besuch bei uns ihre Koffer füllen und damit die knappen Rationen ihrer Familien aufbessern.
Nicht weit von unserem Ort war im Wald ein Munitionslager eingerichtet worden. Wenn die amerikanischen Bomber über uns ihre Streifen zogen, mussten wir auch mit Bombenabwurf rechnen, doch wurden wir zu der Zeit verschont.
Zufluchtsort und Einberufung
Wie verändert war die Stimmung etwa ab Jahresmitte 1944! Vorbei waren Begeisterung und Siegestaumel. Angst und Resignation griffen mehr und mehr um sich. Die Leute fragten uns: »Was wird die Rote Armee mit uns machen?« Ostpreußen wurde unsagbar heimgesucht. Meine Oma mütterlicherseits starb am 10. September auf der Flucht. Opa Jopp flüchtete sich zu uns wie ein verjagtes Reh. Nach einigen Wochen fuhr er mit der Bahn nach Sachsen, um Tante Herta, die Schwester meiner Mutter, dort zu treffen. Papa schrieb auch an seinen Bruder, Onkel Fritz, und lud ihn und Tante Marta aus Erlental ein: »Wenn ihr flüchten müsst, dann kommt zu uns. Herzen und Türen stehen Euch offen!«
Am 30. Oktober erreichte uns der dritte und letzte Einberufungsbescheid. Einige Tage später mussten wir am Bahnhof von unserem Papa Abschied nehmen. Es war schwer, aber welch eine Gnade, dass er so lange hatte bei uns sein können. »Betet für mich«, waren seine letzten Worte aus dem abfahrenden Zug.
Der Trennungsschmerz musste rasch überwunden werden, denn aus Erlental kam die Nachricht: »Wir kommen!« Onkel Fritz hatte noch mit sechzig Jahren zum Volkssturm müssen. Tante Marta kam mit unseren Cousinen Ruth, Lydia und Wanda per Bahn zu uns. Zunächst kamen sie mit Handgepäck. Doch es folgten noch zwei Waggons mit vier Pferden, einem Fohlen, zwei Ackerwagen und einer Menge Kisten mit Hausrat. Das gab Arbeit, denn für alles wurde Platz gebraucht. Aber die Nachbarn halfen mit.
Durch diese schnelle Entscheidung hatte Tante Marta sich nicht nur mit ihren Töchtern gerettet, sie hatte sich die Flucht im harten Winter erspart. Freilich wussten wir alle nicht, was das neue Jahr uns bringen würde.
Dritte Flucht
Immer mehr Flüchtlingswagen kamen aus dem Osten. Die Leute berichteten erschütternde Erlebnisse. Im Übrigen war es bis Februar 1945 bei uns ruhig. Wir hatten von Tante Marta ein Pferd abgekauft, und ich begann Ende des Monats zu pflügen, denn die Witterung war angenehm mild. Mit dem 1. März änderte sich das Bild. Zurückweichende deutsche Soldaten hoben Gräben aus. Kanonendonner kündete die heranrückende Front an. Aber unser Treckleiter zögerte. Endlich am 4. März kam die Meldung zum Aufbruch für unseren Ortsteil. Es war allerhöchste Zeit. In der Nacht reihte sich Wagen an Wagen, elf an der Zahl, alle mit spitzen oder runden Dächern versehen und mit Flüchtlingsgut beladen. Zurück blieben die Bauernhöfe mit den brüllenden Tieren in den Ställen … Eine unvergessliche Nacht! Als wir traurig zurückblickten, beruhigte Mama uns mit den Worten:
»Der HERR hat’s gegeben, der HERR hat’s genommen; der Name des HERRN sei gelobt!« (Hiob 1,21)
Zwei Menschen blieben in unserem Dorf zurück: Opa und Oma Bodem. Mit überraschender Bestimmtheit hatten sie uns erklärt: »Wir bleiben hier!« Wie wir noch erfahren sollten, hatten sie für ihren Teil richtig entschieden.
Fortsetzung folgt Teil 3

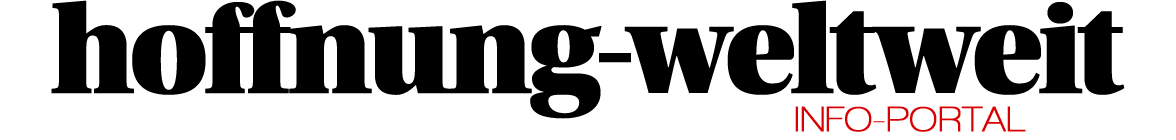

Schreibe einen Kommentar