Zwei Frauen wagen das Unmögliche und trotzen den Elementen. Von Ellen White
Rome, New York: Schwester Sara [McEnterfer] und ich verließen Battle Creek Richtung Williamsport, wo wir auf einem Campmeeting dienen sollten. Wir nahmen den Mitternachtszug. Schon seit drei Tagen regnete es in Strömen. Mit drei Stunden Verspätung trafen wir in Buffalo ein und hatten fünf Stunden Aufenthalt. Denn der Zug war sehr langsam gefahren, weil, so sagte man uns, das Erdreich durch den Dauerregen derart aufgeweicht war, dass der Zug auf den steilen Trassen umkippen könnte. Diese Vorsicht war ja sehr lobenswert und auch unbedingt nötig, aber uns brachte es in große Verlegenheit.
Unser Anschlusszug war schon weg, als wir in Buffalo eintrafen. So bestiegen wir nach fünf Stunden Wartezeit den Zug nach Elmira. Es war schon spät abends und man sagte uns, wir könnten in der Nacht wegen der Flutkatastrophe nicht mehr weiter nach Williamsport. Zugbrücken seien angeblich auf der Strecke eingestürzt, Trassenabschnitte weggespült worden. Man riet uns dringend, in Elmira zu bleiben. Aber wir beschlossen, mit dem Zug so weit wie möglich zu fahren und im Namen des HERRN alles zu tun, was wir konnten, um zur Versammlung zu gelangen. Denn wir waren ja im Dienst!
Unfreiwillige Sabbatpause
Aber wir kamen nur ein paar Kilometer weit. Dann standen wir die ganze Nacht und den ganzen Sabbat bis 17 Uhr auf einem Nebengleis. Glücklicherweise war unser Waggon leer bis auf eine Familie: Bruder Taft, seine Frau und ihre beiden Kinder, die auch auf dem Weg zum Campmeeting waren.
Verwüstung in Pennsylvania
Nach 17 Uhr fuhr der Zug langsam ins zweieinhalb Kilometer entfernte Canton. Wir überfuhren auch ein Balkengitter über der grauenvollen Schlucht, die durch den Sturm entstanden war. In Canton angekommen, hörten wir die schlimmsten Berichte: Brücken, Bahnbrücken wären weggespült, auch Landstraßen. Man riet uns, zurück nach Elmira zu fahren. Doch dieser Rückschritt leuchtete uns nicht ein. Wir wollten vor- und nicht zurückfahren. Viele Passagiere beschlossen umzukehren, aber ein Bote kam mit der Nachricht, dass sie gar nicht nach Elmira zurück könnten. Direkt nachdem wir Elmira verlassen hätten, sei eine Brücke hinter uns weggespült worden. So waren viele Passagiere in den Waggons genötigt, von Samstagabend bis Montag an Bord auf einem Abstellgleis zu bleiben.
Wir aber suchten ein Hotel und fanden ein bequemes Zimmer, in dem wir bis Montag bleiben konnten. Als wir uns umschauten, sahen wir die Verwüstung, die der Sturm angerichtet hatte. Männer waren schwer damit beschäftigt, die Schäden zu beseitigen, denn die Trasse war zehn Meter tief unterspült. Ein provisorisches Balkengitter für die Gleise war errichtet worden, damit der Zug nach Canton weiterfahren könnte. Aber es würde noch Wochen dauern, bevor ein Zug von Canton aus weiterfahren würde. In Canton direkt waren Brücken, Straßen und Gebäude weggerissen, riesige Bäume entwurzelt worden. Ein Mann war gerade in seiner Scheune gewesen, als die Fluten sie mitrissen. Am nächsten Morgen, dem Sabbat, hatte man seinen leblosen Körper gefunden und in den Sarg gelegt.
Nicht einmal für 100 Dollar
Wir boten unserem Mieter 10 Dollar an, wenn er uns nach Williamsport bringen würde. Doch nachdem er sich erkundigt hatte, sagte er uns, die Straßen ließen das nicht zu. 15 Kilometer hinter Canton bei Roaring Branch war eine Gemeinde. Die Geschwister erfuhren, dass wir in Canton waren, wagten sich über die noch passierbaren Gleise und nahmen uns in ihre Häuser mit, die wir Montagabend erreichten. Alle, die wir fragten, sagten, es sei unmöglich, nach Williamsport weiterzureisen.
So gern sie das angebotene Geld auch genommen hätten, nicht einmal für 100 Dollar hätten sie es gewagt. Ein anderer Mann sagte, für 1000 Dollar würde er es mit seiner Kutsche wagen.
Auf unwegsamer Straße über die Berge
Sara und ich sahen den traurigen Zustand der Straßen, aber wir sprachen mit Bruder Rockwell. Er überlegte, ob er es vielleicht über die Bergstraße versuchen sollte. Wir sagten, wir würden für alle Kosten aufkommen, wir würden dem HERRN vertrauen, dass er uns vor Unfall und Schaden bewahren und uns den Weg ebnen würde.
Starke und treue Pferde wurden besorgt, und die Reise konnte losgehen. Wir sahen unbeschreibliche Straßen. Die Erde war weggespült. Wo einst eine Straße war, waren nun Steinhaufen, tiefe Löcher, entwurzelte Bäume, Trümmer und Müllberge – Brücken fehlten völlig. Es gab tiefe Gräben. Sara und ich überquerten eine schmale Planke, die man gelegt hatte, um einen solchen Graben zu überbrücken. Wir liefen oft einen halben, einen ganzen oder zwei Kilometer zu Fuß, damit die Kutsche diese schwierigen Stellen überwinden konnte.
Ich hatte mir den Fuß verstaucht und war tagelang auf Krücken gelaufen, bevor wir Battle Creek verlassen hatten. Doch jetzt lief ich über das felsige, unebene Gelände, sprang über breite Spalten, erklomm Hügel und ließ mich durch nichts erschrecken oder einschüchtern. Um drei Uhr fing es zu regnen an. Wir suchten ein bewohntes Haus, wo wir über Nacht bleiben könnten. Verlassene Häuser, alte Sägemühlen, aber auf fast 30 km keine Bewohner. Die Dämmerung brach herein und ließ es nicht ratsam erscheinen, auf solchen Waldwegen nach Einbruch der Dunkelheit unterwegs zu sein. Einmal lagen Baumstämme quer über dem Weg und wir brachen uns das Querholz, an dem die Stränge des Pferdegeschirrs befestigt sind, als wir mit der Kutsche darüberfuhren. Ein weiterer Baum, der über den Weg lag, musste zersägt werden; einen anderen umfuhren wir, nachdem wir eine kurze Schneise durch den Wald geschlagen hatten. Welch willkommener Anblick bot doch das Dorf, das schließlich in einem engen Talbecken auftauchte!
Verwüstung am Forellenbach
Wir fragten einen Dänen, der ein Hotel führte, ob er uns aufnehmen könne. Er sagte, er hätte ein Bett, aber keine »Fressalien« mehr. Wir hatten noch etwas zu Essen bei uns, deshalb störten wir uns nicht daran. Aber als wir jemand dort fragten, ob wir den Forellenbach (Trout Run) überqueren könnten, sagte er uns, der schnelle Bach sei so stark angeschwollen, dass er das gleichnamige Dorf wahrscheinlich dem Erdboden gleichmachen würde.
Am Mittwochmorgen schauten wir uns um. Ich hätte nicht geglaubt, dass ein paar Regentage solche Verwüstung anrichten konnten. Allerhand Müll, Zäune, alte Schränke, Holzscheite und was man sich nur an Trümmern vorstellen kann, kam das Tal heruntergerauscht und riss alles mit sich, die Brücke, die Gleise und stapelte alles grotesk übereinander.
Wir betraten das Haus einer Frau, die mir zeigte, was das Wasser bei ihnen angerichtet hatte. Sie hatten zwei Hektar mit fruchtbarem, gut bebautem Boden gehabt. Doch als wir hinausgingen, sahen wir abgebrochene und entwurzelte Bäume. Dies sei angeblich das schönste Anwesen dort gewesen, aber mir brach fast das Herz bei dem Anblick. Ich lief auf knapp metertiefem Sand, der ein Kornfeld unter sich begrub. Es war einfach unbeschreiblich.
Gewagte Flussüberquerung
Was konnten wir tun? Was war der beste Weg? Den Forellenbach könne man nicht durchqueren, sagte man uns. Wir sagten: »Tun Sie für uns, was Sie können! Wir müssen ans andere Flussufer.« Es dauerte drei Stunden, um ein Floß herzurichten. Ein Boot wurde gemietet, ein langes Seil, das einer im Boot festhielt, wurde an eines unserer Kutschpferde gebunden. Man ließ das Pferd hinüberschwimmen. Ein- oder zweimal entschwand es meinen Blicken. Als es am steilen Ufer hinausklettern wollte – steiler und schwieriger als ein Hausdach, weil es überstand; die Erde zwischen dem Weg und dem Fluss war weggespült worden – da kletterte es nach mehreren erfolglosen Versuchen an verschiedenen Stellen dann schließlich doch das Ufer hoch. Jetzt wurde das zweite Pferd hinübergeritten. Es war das größere und weniger nervöse von den beiden Kutschpferden. Als es gut aufs andere Ufer hinaufkam, weinte ich wie ein Kind und lobte laut den HERRN.
Der nächste Schritt war das Übersetzen mit dem Floß, was mit allen Vorbereitungen viel Zeit kostete. Die Kutsche wurde sicher darauf befestigt und mit Seilen gesichert. Das Floß wurde mit einem Seil ans Boot gebunden und durch beachtliches Manövrieren ans andere Ufer gezogen. Bald saßen wir alle in der Kutsche und waren dankbaren Herzens wieder unterwegs.
Ankunft in Williamsport
Noch bevor wir das Zeltlager erreichten, sagte man uns, das Lager sei abgebrochen worden, weil es einen Meter unter Wasser stünde. Als wir in Williamsport einfuhren, sahen wir wieder die Verwüstung der Wassermassen. Häuser waren umgestürzt, wir aber waren nur nass geworden. Etwa fünfzig Menschen hatten ihr Leben gelassen. So plötzlich war die Flut gekommen, dass sie kaum Zeit hatten, sich über die Gefahr klarzuwerden. Williamsport war im absoluten Ausnahmezustand, was die Straßen und Gehwege anbetraf. Schutt und Gerümpel waren wahllos zu Haufen aufgetürmt. Dies war einmal ein schöner Ort gewesen, doch sein Glanz war gewichen. Jeder Laden in der Stadt war zerstört. Ich kann es gar nicht beschreiben.
Eine ältere farbige Frau redete voller Eifer. Sie sagte: »Das ist der Fluch Gottes wegen der Boshaftigkeit dieses Ortes. Es ist einfach nur schrecklich!«
Das Wasser reichte bis zum Zeltlager. Die aufgeschlagenen Zelte mussten weiter nach oben umziehen.
Als wir am Mittwoch im Lager ankamen, waren alle überrascht, uns zu sehen. Sie waren so froh wie wir, dass wir wohlbehalten angekommen waren. Die Telegraphenverbindungen waren unterbrochen; so hatte niemand gewusst, wo wir uns befanden. Der HERR gab mir Kraft, dreizehn Vorträge in Williamsport zu halten. Fast alles, was es in den Läden an Essbarem gab, war nass geworden und roch und schmeckte so schlecht, dass es ungenießbar war. So stellte sich unser Essen eher mager dar. Aber murren wollten wir nicht.
Johnstown – ein Beispiel für kommende Katastrophen
Die schlimmste Flutkatastrophe hatte das etwa 200 km weiter im Südwesten gelegene Johnstown ereilt. Fast die ganze Stadt war dem Erdboden gleichgemacht worden. Es soll ein sehr sündhafter Ort gewesen sein. Wir konnten nur an die erste Flut denken, die über unsere Welt kam. Diese Katastrophen werden häufiger werden. Denn der Geist des HERRN zieht sich langsam aber sicher von der Erde zurück. Die Macht, mit der der HERR Satan in Schranken hält, wird weggenommen. Er hindert ihn nicht mehr daran, mit den Bewohnern dieser Welt sein Spiel zu treiben.
Was wirklich hinter den Katastrophen steckt
Unsere einzige Sicherheit besteht darin, ganz auf des HERRN Seite zu stehen. Wir können nicht gefahrlos dem Feind Raum geben. Denn wenn wir uns auf der Seite des Feindes befinden, werden wir mit den Bösen in den Plagen umkommen, die Satan auf der Erde gegen Menschen und Tiere mit des HERRN Erlaubnis bewirken darf. Die schreckliche Katastrophe in Johnstown und den umliegenden Städtchen hat gewiss Angst und Schrecken verbreitet, Menschen aufgerüttelt. Aber ich fürchte, dieser Eindruck wird schnell wieder verblassen.
Quelle: egwwritings.org, {Lt54–1889}; Brief vom 13. Juni 1889

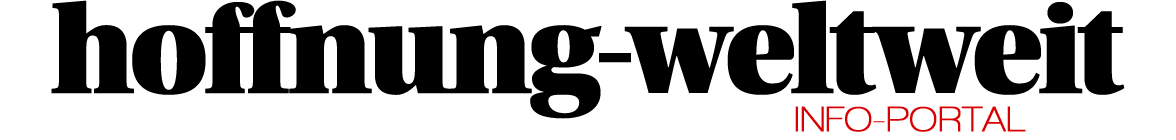

Schreibe einen Kommentar