… und der Versuch einer Rückkehr nach Hause. Von Gerhard Bodem
Rückblick Teil 1: Ich wurde 1931 auf einem Bauernhof in Ostpreußen geboren. Um dem Wehrsport im Grenzgebiet zu entkommen, zog mein Vater mit uns 1934 nach Pommern, wo zwei Jahre später meine Mutter verstarb. Als ich an Lungentuberkulose erkrankte, gaben mich die Ärzte auf.
Rückblick Teil 2: Zum Erstaunen der Ärzte erholte ich mich. Nicht lange danach heiratete mein Vater wieder. Die Kriegsjahre erlebten wir auf unserem Bauernhof in Pommern. Im Oktober 1944 wurde mein Vater eingezogen und am 4. März 1945 mussten wir vor der nahenden Front fliehen.
Unser Treck bewegte sich vorwärts in südlicher Richtung der Autobahn zu. In Gollnow (heute: Goleniów) waren die Straßen verstopft. Wir kamen nur sehr langsam voran. Helene, unser Polenmädchen, hatte uns mit Mamas Fahrrad begleitet. Aber nun entschloss sie sich, zusammen mit anderen Polen in der Stadt zu bleiben und den Einmarsch der Russen abzuwarten.
Luftangriff
Endlich hatten wir die Autobahn erreicht. Eine Fahrbahn war mit Flüchtlingswagen gefüllt, die andere mit Militärfahrzeugen. Wie und wo wollten wir mit unserem Treck dort noch eine Lücke finden? Irgendwie war es schließlich doch gelungen. Wir hatten uns eingefädelt in die endlose Schlange von Pferdewagen. Alle hatten ein gemeinsames Ziel: sobald wie möglich im Süden von Stettin die Oderbrücke zu erreichen! Als Stunde um Stunde verging, war ich mit meiner Schwester Hannchen im Wageninnern eingeschlafen. Mama hielt die Zügel noch in der Hand und kämpfte gegen die Müdigkeit. Als wir gerade ein Waldstück erreicht hatten, kamen sowjetische Jagdflugzeuge geflogen und nicht weit von uns brach ein furchtbarer Donner los: Sperrfeuer durch Fliegerabwehrkanonen. Die Pferde erschraken und bäumten sich auf. Eine Panik auf der Autobahn! Unser Wagen rollte rückwärts und nach rechts, stürzte dann die Böschung hinunter in den tiefen Graben. Mama war auf den Acker geschleudert worden, Hanna und ich, Gerhard, im Wageninnern lebendig begraben.
Mama schrie um Hilfe, bis Soldaten kamen, die aber wieder wegliefen nach ihrem Blick auf den umgestürzten Wagen mit den Worten: »Frau, da ist doch nichts mehr zu retten!« Mama rief weiter: »Hilfe, Hilfe, meine Kinder sind unter dem ganzen Gepäck begraben!« Wie lange es gedauert hat, bis Hilfe kam, weiß unser HERR. Er weiß auch, wie lange man aushalten kann bis zum Erstickungstod. Für mich schien es aus zu sein in dieser qualvollen Lage. Doch gerade dann kamen zwei Soldaten, räumten Säcke und Gepäck weg und zogen uns aus dem Graben. Nach einer halben Stunde hatten wir uns etwas erholt von dem Schock. Wir zitterten am ganzen Leib und wünschten, dass uns irgendjemand mitnehmen würde. Wenn Papa jetzt bei uns wäre! Sicher war er in einem Feldlazarett und half den Schwerverwundeten. Also nicht jammern, wir waren doch – welch ein Wunder – alle drei unverletzt geblieben!
Zunächst blieben weitere Hilferufe ohne Antwort. Es war auch schwierig für die Flüchtenden, aus der Kolonne auszuscheren. Und die Soldaten hatten es sehr eilig. Schließlich erbarmte sich ein älterer Bauer und half uns, den umgestürzten Wagen in Einzelteilen die Böschung hinaufzuziehen und zu reparieren. Danach schleppten wir Stück um Stück von der verstreuten Ladung zum Autobahnrand. Leuchtkugeln erhellten zwischendurch die Nacht. Die Engel Gottes waren unser Schutz. Als der Morgen graute, war der Wagen wieder beladen und wir konnten uns in die Reihe der Flüchtenden einfügen, ja manchmal einige Wagen überholen. Das war ein weiteres Wunder. Als wir uns der Oderbrücke näherten, bot sich uns ein grauenvolles Bild: Menschen und Pferde lagen tot auf dem Mittelstreifen, getroffen von den Bordwaffen der Flieger. Das war »totaler Krieg«. Wir mussten weiter eilen über die lange Brücke in der Hoffnung, irgendwann unseren Treck wieder einholen zu können. Unablässig hielten wir Ausschau nach unseren Leuten.
Von der Oder nach Greifswald
Da, auf einmal entdeckte ich auf der Autobahnüberführung ein bekanntes Pferd: Das war doch Minkenbergs Lotte! »Ja, das sind unsere Nachbarsleute!«, jubelte Mama. Gerade noch kurz vor der Ausfahrt dies wunderbare Erlebnis! Sofort bogen wir rechts ab und holten unsere Leute ein, als sie einen Rastplatz suchten. Das gab ein frohes Wiedersehen! Ruth, Wanda und Lydia liefen uns entgegen und schlossen uns in die Arme. Freude und Dankbarkeit auf beiden Seiten, denn aller Leben war bewahrt worden. Nur Minkenbergs Hund war von Kugeln getroffen worden. In einer großen Scheune, nun auf der Westseite der Oder, konnten wir ausruhen. Die Spannung ließ nach und wir schliefen besser im Stroh als manche Leute in ihren weichen Betten.
In den folgenden Tagen fuhren wir jeweils nur kurze Strecken, besonders den Pferden zuliebe. Auf der Reichsstraße 104 nach Pasewalk gab die Treckleitung Anweisung, in nördlicher Richtung nach Anklam zu fahren. Nach einigen Tagen näherten wir uns der Stadt Greifswald. Da kam plötzlich eine unerfreuliche Meldung, die von Wagen zu Wagen weitergegeben wurde: »Zurück nach Anklam. Alle Straßen und Ortschaften sind überflutet mit Militär und Flüchtlingen. Ein Durchkommen ist aussichtslos!«
Verschnaufpause in Buggow
Wohl oder übel, wir mussten alle gehorchen und wenden. Nach einigem Suchen fanden wir schließlich ein Dorf abseits der Hauptstraße, das noch einige Flüchtlinge aufnehmen konnte. Es war das Siedlerdorf Buggow in Vorpommern. Hier fanden wir Notunterkünfte bei Bauern und Siedlern am 16. März 1945. Familie Rohde machte uns einen Raum frei und war recht freundlich. Wie war das wohltuend! Endlich konnten wir Hannas Frostbeulen richtig behandeln. Mama half gleich in der Küche mit und dann gab es etwas Gutes zu essen. Gleich am folgenden Tag schrieben wir einen Brief an unseren Papa und erhielten auch bald Antwort. Er war noch im Einsatz im Feldlazarett.
Eines Tages wurden wir Jugendlichen aufgefordert, die Schule zu besuchen. Auch die Hitlerjugend wollte uns »registrieren«. Diese verblendeten Jungen glaubten immer noch den Göbbel’schen Propagandaparolen von heldenhafter Wehr und dem Sieg durch Wunderwaffen. Wir halfen in jenen Tagen den Gastgebern in Haus, Garten und Feld. Am 23. April fasste Mama den kühnen Entschluss, unseren Papa an der Front zu besuchen. Das Wagnis sollte gelingen. Behütet von Engeln Gottes erreichte sie ihn kurz vor dem Rückzug von der Oderfront. Mit Militärfahrzeugen kam sie gerade noch vor dem letzten Aufbruch zurück.
Unser Treckleiter hatte den Entschluss gefasst, die Flucht fortzusetzen. Das waren für uns Kinder bange Stunden, bis Mama gerade noch vor der Weiterfahrt eintraf. Wo sollten wir nun noch hin? Es wäre sicher besser gewesen, in Buggow zu bleiben.
Potthagen und die Hölle
Am 30. April erreichten wir Greifswald. Da standen wir auf dem Marktplatz und hörten nur Schreckensnachrichten. In Potthagen fanden wir endlich Notunterkünfte. Die Stadtväter beschlossen die kampflose Übergabe der Stadt und angrenzender Ortschaften. Die Leute vernichteten die vorhandenen Hakenkreuzfahnen und überall wurden weiße Fahnen gehisst. Wir Flüchtlinge benutzten Bettlaken oder weiße Handtücher als Zeichen der Übergabe. Für uns war der Krieg zwar zu Ende, aber große Angst erfüllte die Herzen der Menschen. Im Laufe des Nachmittags wurden die Stadt und auch der Ort Potthagen besetzt. Zuerst rollten die Kettenfahrzeuge durch die Straßen. Dann folgten die Mannschaftswagen. Wir Flüchtlinge saßen in einem Raum auf ausgebreitetem Stroh und warteten gespannt auf die ersten Soldaten. Mama betete, und als sie kamen, wurde es für die Frauen und Mädchen gefährlich. Fluchtartig verließen sie nacheinander den Raum und versteckten sich. Wir erlebten Bewahrung des Lebens, aber alles andere wurde uns nacheinander genommen: Pferde, Wagen, Kleidung, Schmuck, Esswaren usw. Die folgende Nacht und der 1. Mai waren so schlimm, dass ich die einzelnen Erlebnisse nicht schildern will. In dieser »Hölle« konnten wir nicht bleiben, aber wohin?
Zurück nach Hause auf den Hof
Wir schlossen uns einem Trupp von nun freien Serben, Franzosen, Ungarn und Polen an. Gemeinsam zogen wir ostwärts die Straßen, die wir hergekommen waren. In Stettin war der Sammelplatz für die ehemaligen Zivilgefangenen. Mitunter stellten sich Serben vor unsere Frauen und Mädchen, die sich in lange Mäntel gehüllt hatten, um älter zu erscheinen. In Stettin trennten sich unsere Wege. Wir Flüchtlinge pilgerten weiter über unsere Einkaufsstadt Gollnow in unser zweites Heimatstädtchen Kahlbruch (heute Kałużna bei Osina).
Es war jetzt der 16. Mai 1945
In der Stadt gab es reichlich Trümmer. Hin und wieder fanden wir noch brauchbare Gegenstände. Verwesungsgeruch erfüllte die Luft. Der Höft-Hof war durch Brand zerstört worden. Die Kühe lagen verkohlt an den Ketten. Die anderen Gehöfte standen noch. Die ersten Häuser waren fast leer, die Einrichtungsgegenstände verschwunden oder demoliert. Vorsichtig und voller Spannung gingen wir weiter zum Ortsende. Dort hatten wir uns am 4. März von den Großeltern getrennt. Dem HERRN sei Lob und Dank, Opa und Oma waren am Leben und freuten sich sehr, als sie uns erkannten. Da sie polnisch sprechen konnten, hatten sie in ihrer Wohnung bleiben dürfen. Ein weiß-rotes Fähnchen war an ihrem Fensterrahmen befestigt.
Nachdem wir uns ein wenig ausgeruht und unsere Erlebnisse ausgetauscht hatten, pilgerten wir endlich zu »unserem« Haus. Nie zuvor war uns das Wort so real, dass wir in dieser Welt nur »Gäste und Fremdlinge« sind. Es kam uns in jenen Tagen alles »fremd« und anders vor. Keines der Tiere war mehr da, mit denen wir doch verbunden gewesen waren. Als wir in den Stall gingen, wagten wir fast nicht mehr zu atmen, so reizte Verwesungsgeruch wieder einmal unsere Schleimhäute. Es galt also nun aufzuräumen und die verwesenden Tierkadaver zu begraben. Es musste repariert und improvisiert werden. In der Stadt hatten wir Samentüten gefunden und mitgenommen. Der Garten wurde umgegraben. Es wurde gesät und gepflanzt, soweit der Vorrat reichte. Von den vorhandenen Kartoffeln und den Getreidekörnern lebten wir, bis der Tag kam, da die »Rechnung« für den Krieg bezahlt werden musste.
In jenen sechs Wochen der Unsicherheit und Ungewissheit erlebten wir laufend Gottes Schutz und gnadenvolle Hilfe. Wenn uns Kleidung und selbst das frisch gebackene Brot geraubt wurde, schroteten wir den noch vorhandenen Roggen mit der Kaffeemühle und buken neues Brot. Als unsere Nachbarin vergewaltigt werden sollte, eilte Mama mit großem Geschrei herbei. Sie bekam eine Ohrfeige, aber die Soldaten zogen sich irgendwie verstört zurück.
Soldat mit Tränen in den Augen
Bemerkenswert ist noch folgendes Erlebnis: Drei Soldaten wollten mich entführen. Ich floh und versteckte mich für einige Stunden im Kornfeld. Kaum war ich wieder im Hause, da tauchten diese Männer plötzlich auf und steuerten ebenfalls auf die Haustür zu. Wir drei fielen rasch auf die Knie und Mama betete ernstlich um Gottes Hilfe. Die Haustür wurde geöffnet und die Männer drangen in die Küche ein.
Mama betete weiter, auch als die Tür zum Wohnzimmer aufgerissen wurde. Solange die Soldaten uns auf den Knien liegen sahen, blieben sie stehen. Gottes Geist hatte sie offenbar besänftigt. Erst als Mutter »Amen« sagte, öffneten wir unsere Augen und erlebten eine Gebetserhörung. Mindestens einer von den Dreien hatte Tränen in den Augen und bemühte sich, uns klarzumachen, dass sie uns nichts antun würden. Wir durften weiterhin zusammenbleiben und die nächste »Wanderung« durchstehen.
»Durch den Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen … ohne zu wissen, wohin er kommen werde … denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist.« (Hebräer 11,8-10)
Heimatvertriebene
Am Mittwoch, dem 27. Juni 1945, ging die Sonne wie immer pünktlich auf. Auch für diesen Tag galt das Verheißungswort: »Siehe, ICH bin bei euch alle Tage – bis an der Welt Ende.« (Matthäus 28,20) Unser himmlischer Vater bleibt unbeirrt seinen Verheißungen treu, auch in den Wechselfällen menschlichen Lebens und Leidens.
42 Tage lang waren wir beschäftigt gewesen mit der Reinigung und Instandhaltung der Gebäude und mit der Garten- und Feldbestellung. Unser Gott gab Wachstum und auch schon die erste Ernte im Garten. Wir hatten Brot und Wasser, wir hatten auch Salat zu den Kartoffeln (nur kein Öl und keine Butter). Die Haupternte hatten wir anderen zu überlassen.
Es sollte unser letzter Tag in Pommern gewesen sein.
Fortsetzung folgt Teil 4

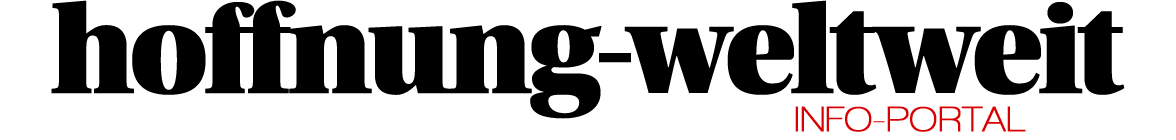

Schreibe einen Kommentar