Wenn das Leben uns enttäuscht. Die heilsame Talfahrt beginnt. Von Bryan Gallant
»Das Leben gehört den Lebenden, und wer lebt, muss auf Wechsel gefasst sein.« Johann Wolfgang von Goethe
Änderungen geschehen fortlaufend. Auch wenn es vielen nicht gefällt: Es ist das Einzige, was sich nicht ändert. Im Leben gibt es keinen Stillstand. Wir stehen immer wieder vor neuen Situationen. So erging es auch mir.
Lehrer auf einer Tropeninsel
Im Jahr 1988 meldete ich mich als Student für ein Volontariat als Lehrer auf der Insel Chuuk (damals hieß sie noch Truk), einem Atoll das zu Mikronesien gehört. Mit knapp hundert anderen Volontären aus verschiedenen Universitäten wurde ich zuerst für ein paar Tage nach Hawaii gebracht, wo wir einen Lehrer-Crashkurs für die Aufgabe auf den verschiedenen Inseln im Nordpazifik absolvierten. An sich ein edles Ansinnen, Studenten nach Hawaii zu holen und zu meinen, sie werden viel lernen, wenn Sonne, Strand und Bikinis überall locken! Nun, wir waren da, entschlossen, das nächste Jahr unseres Lebens im Dienst für andere zu verbringen. Was für eine willkommene und schöne Abwechslung zum Leben auf dem Campus! Hier kann man Wellen reiten, schnorcheln und vielleicht sogar die große Liebe finden. An geniale Unterrichtstechniken aus dieser Woche kann ich mich jedoch nicht erinnern, aber Spaß hatten wir allemal in Hawaii.

Bild: Bryan im Dschungel der Insel Truk (heute Chuuk/Mikronesien). Hier machte er ein einjähriges Volontariat als Lehrer einer achten Klasse.
Fast sofort begegnete ich Penny. Wir waren noch in Hawaii zum Lernen, da machten wir nach wenigen Tagen schon einen gemeinsamen Ausflug. Ich bin mir nicht sicher, ob einer von uns ihn als Rendezvous bezeichnet hätte. Wir hatten einfach beide die Gruppe von Studenten auf der Insel angeschaut und gefunden, dass wir am besten zueinander passten. Romantisch? Vielleicht. Ein gemeinsamer Akt der Verzweiflung? Im Rückblick hatten wir beide unsere Gründe, warum wir nach der großen Liebe Ausschau hielten. Als wir dann Hawaii verließen, waren wir aneinander interessiert und planten eine gemeinsame Zukunft.
Auf der fantastischen Insel Chuuk stellten wir uns auf unseren neuen Tagesablauf als Lehrer ein und gingen in die Vollen. Penny unterrichtete die zweite Klasse. Das waren 32 Schüler in einem Raum im ersten Stock, in den eigentlich nur 20 passten, auf provisorischen Schulbänken, mit Löchern im Fußboden und einer hauchdünnen Wand, die wie ein Schiedsrichter zwischen beiden überfüllten Nachbarklassen stand, um zu entscheiden, welche am lautesten war. Die Schule hatte ein Wellblechdach, das die häufigen Regenschauer in einen Angriff auf Pearl Harbor mit Bomben und Maschinengewehrfeuer verwandelte, sodass der Unterricht geduckt in der Ecke hocken musste. Lärm, Chaos und unwirksame Unterrichtsmethoden überwiegen in Pennys Erinnerung. Hoffentlich haben ihre Schüler mehr davon gehabt als nur das.
Meine Wenigkeit durfte die Elitetruppe der Achtklässler unterrichten. Ein paar waren sehr gescheit. Andere waren schon fortgeschrittenen Alters. Warum sie noch die Schule besuchten, war mir schleierhaft. Einer war nur ein Jahr jünger als ich! Ein 18-Jähriger Achtklässler! Wo gab es denn so etwas? Ich gehe mal davon aus, dass ich gar nicht schlecht unterrichtete. Besonders zu den besseren Schülern fühlte ich mich hingezogen. Sie haben dann auch ihre Abschlussprüfungen gut bestanden, drei schafften es auf die beste Highschool der Insel (ein Rekord damals).
Meine große Liebe
In jenem Jahr waren wir neun Lehrer, zwei Männer und sieben Frauen. Ich hatte also gute Chancen bei Penny. Denn ich hatte praktisch keine Rivalen. Dem anderen Amerikaner blieb ohnehin die größere Auswahl! In der Nähe arbeitete ein netter Filipino, der Penny eine Zeitlang umschwärmte. Er hatte eine schöne Stimme und spielte Gitarre. Doch schließlich zahlte sich meine Beharrlichkeit aus. Innerhalb von drei Monaten waren Penny und ich verlobt und später, im Juni 1989, eine Woche nach unserer Rückkehr in die USA, gingen wir den Bund fürs Leben ein – wir heirateten. Die Feier fand in einem Standesamt statt. Eine weitere Feier sollte im August mit meiner Familie stattfinden, sobald sie von Alaska herunterfahren konnte. Jung und unerfahren waren wir nun verheiratet und führten ein Leben, das vor Fehlfunktionen nur so strotzte. Es war ein Jahr mit radikalen und schnellen Veränderungen gewesen.

Bild: Bryan (21) und Penny (20): verliebt, verlobt, verheiratet in nur zehn Monaten. Die Hochzeit dieser Tropenliebe fand 1989 statt.
Jung verheiratet zu sein war kein Kinderspiel. Im »realen« Leben hatten wir uns nämlich bisher noch nicht kennen gelernt. Als Volontär auf einer idyllischen Tropeninsel gerät man leicht unter einen Zauber. Wir waren uns begegnet, waren Hand in Hand bei Sonnenuntergang am Strand spazieren gegangen. Verliebt, verlobt, verheiratet – in zehn Monaten! Wir waren zwei Kinder 21 und 20, die jetzt miteinander verbunden waren. Keine Arbeitsstelle, kein Geld, viele würden sagen: keine aussichtsreiche Zukunft! Aber wir liebten uns doch! So dachten wir wenigstens. Liebe, wie wir sie auch definieren, ändert sich stetig. Sie muss sich ändern und wachsen, sonst stirbt sie.
Streit gab es über so manches. Hier versuchten zwei gebrochene Menschen gemeinsam das Leben zu meistern. Jemand sagte einmal, dass jede Ehe aus sechs Personen besteht – dem Mann, für den ich mich halte, dem Mann, für den Penny mich hält und dem Mann, der ich tief innen wirklich bin (obwohl es mir vielleicht gar nicht bewusst ist); zusammen mit der Frau, für die ich sie halte, der Frau, für die sie sich hält und der Frau, die sie wirklich ist (obwohl es auch ihr wahrscheinlich gar nicht klar ist). Die Aufgabe der Ehe besteht nun darin, diese sechs Personen in eine einzige zu verschmelzen! Dies ist in der Regel kein friedliches Unterfangen. Aber wir stürzten uns ins Getümmel: Auf die Plätze, fertig, los!
Berufliche Enttäuschungen
Nach ein paar gescheiterten Versuchen Netzwerk-Marketing-Gesundheitsprodukte zu verkaufen – und sogar Gebrauchtwagen – begann ich, meinen Lebensunterhalt durch den Verkauf von Büchern an der Haustüre zu bestreiten. Es waren gute Bücher; Bücher über Gott und die Bibel. Ich hatte immer für Gott arbeiten wollen, aber mir fehlte die Selbstbeherrschung oder Geduld, mich einer Ausbildung zu unterziehen oder die Hochschulreife zu erwerben, sodass ich hätte Pastor werden können. Tatsächlich hatten weder Penny noch ich die Schule abgeschlossen. Die Gelegenheit, Menschen zu begegnen, Leben zu verändern und ihnen die gute Nachricht zu bringen, schien mir aber eine edle Arbeit zu sein. Offen gesagt, hatte ich damals auch keine andere Wahl! Meine Arbeit machte mir größtenteils Spaß und ich eignete mir eine Menge wertvoller Menschenkenntnis und Gotteserkenntnis an.
Aber obwohl ich völlig in der Arbeit für Gott aufging und obwohl meine Frau bereit war, ihrem jungen Mann ins Unbekannte der vor uns liegenden Jahre zu folgen, war es nicht leicht. Ich bin kein von Natur aus begabter Verkäufer. Daher waren unsere ersten Jahre sehr schwer. Die Tage waren lang, der Lohn niedrig, die Zukunft aussichtslos und die regelmäßigen Misserfolge wurden zwar immer wieder durch kurzzeitige Wunder unterbrochen, wichen dann aber wieder dem Gefühl im großen Plan des Lebens unbrauchbar zu sein. Es war schwer und hinterließ Narben.
Jeder Tag war voller Veränderungen. Es gelang uns einfach nicht, unser Geld einzuteilen. Denn meine Bezahlung bestand nur aus der Provision, die ich durch meine Verkäufe erhielt. Mein Tagesablauf war einerseits Gewohnheit, andererseits der verzweifelte Versuch, mehr zu verdienen. Frischvermählte sollten eigentlich im siebten Himmel schweben und vereint der Welt entgegentreten. Doch in unserem ersten Jahr waren wir mehr getrennt als zusammen.
Pennys Depression
Penny wollte von mir so versorgt und beschützt werden, wie sie es bis dahin von Gott nicht empfunden hatte. Jetzt merkte sie, dass ich nicht viel vertrauenswürdiger war. Zu Hause und auf der Arbeit hatte ich immer das Gefühl ein Versager zu sein. Nach zwei Jahren waren wir aufgrund meiner schlechten Verkaufsleistungen pleite. Gerade wären wir kreditwürdig geworden, da warf uns das wieder zehn Jahre zurück. Inmitten dieser Monate und frühen Jahre glaubte ich, mein Wert ergebe sich aus meiner Leistung. Meine Leistung aber war alles andere als beeindruckend! So sah es also aus: Zwei verstörte, unreife »Kinder«, die alles in den Sand setzten.

Bild: Penny am Strand von Truk. Auch sie arbeitete als Lehrervolontärin an derselben Schule, aber mit jüngeren Kindern.
Penny blieb daheim, langweilte sich, wartete und fragte sich, was ich den lieben, langen Zehn- bis Zwölf-Stunden-Tag so machte. Vielleicht betete sie, wahrscheinlich aber nicht. Da sie in ihrem Leben bis zu diesem Punkt durch ein paar sehr dunkle Täler gegangen war, glaubte sie, dass Gott sie nicht besonders liebte oder beschützte. Sie hatte Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl. Vom Kopf her war sie einem Glaubensetikett treu – wir gingen regelmäßig zur Kirche –, aber ihr Leben mit Gott hatte keine Leuchtkraft. Ihre Beziehung zu Gott war bestenfalls angeschlagen und schlimmstenfalls belanglos. Warum sollte sie bei ihrem Selbstbild dann noch erwarten, dass ihr Mann sich liebevoll um sie kümmert und für sie sorgt? Sie hatte den Eindruck, dass ihr alles recht geschieht!
Als Penny im 18. Monat unserer Ehe eine Fehlgeburt hatte, war sie am Boden zerstört. Wie eine makabere Metapher malte der Tod unseres ungeborenen Kindes ein scheinbar endloses Leben ohne Hoffnung an die Wand. Als ich versuchte den Schmerz zu heilen, den ein Mann nicht verstehen kann, habe ich sie mit meinen Taten wohl so tief verletzt, dass ihre Träume von einem einfühlsamen Mann auch noch starben.
Mein Stolz
Meine Beziehung mit Gott jedoch war auf andere Weise gestört. Äußerlich war ich stark und gewissenhaft, ein vorbildlicher junger Mann. Doch die Fassade war an vielen Stellen mit Angeberei und Stolz versehen. Gott erkennen, bedeutete für mich, Informationen oder theologische Lehren über Gott zu sammeln. Ich dachte, Glaube bedeute, Gott beschreiben zu können und viel über ihn zu wissen. Lernen fiel mir schon immer leicht und ich hatte gelernt meinen Selbstwert aufzupolieren, indem ich mich mit anderen verglich. Zwar war der Erlös aus meinen Verkäufen armselig, aber durch mein beachtliches Bibelwissen fühlte ich mich doch besser und »heiliger« als die meisten. Wegen dieses Lebensstils hatte man mich schon mit 20 in meiner Kirche zum Gemeindeältesten in Chuuk eingesegnet! Meine eigene sachkundige Gerechtigkeit war mein einziger Trost.
Mein Glaube beruhte darauf, dass ich Gott beschreiben, meinen Glauben verteidigen und ihn anderen erklären konnte (auch wenn sie gar nichts davon wissen wollten). Ich handelte, als ob ich Gott kontrollieren, weitergeben, verteidigen und propagieren konnte. Aus der Sicht vieler Kirchenglieder war ich einfach Feuer und Flamme und verteidigte und verkündigte den Glauben unzähligen »verlorenen« Menschen, denen ich jeden Tag begegnete (oder einfach anderen, die nicht meiner Kirche angehörten). Wenn ich zum Gottesdienst oder anderen Veranstaltungen ging, hatte ich immer eine spannende Geschichte oder ein theologisches Thema dabei, ermutigte auf diese Weise andere und steigerte damit gleichzeitig mein Selbstbewusstsein. Die ganze Zeit aber war mein Stolz nur die Maske, hinter der ich meine empfundene Wertlosigkeit versteckte, weil ich mich als Versager fühlte.
Fallen, in die wir tappen
Wir waren vom Leben enttäuscht, mit Löchern in der Seele. Unsere Ehe war leider alles andere als die Lösung dafür. Das hatten wir uns zwar nicht ausgesucht. Man wacht ja nicht morgens auf und sagt: »Hmmm, heute möchte ich gerne verzweifeln und mich wertlos fühlen.« Oder: »Ich glaube, ich bin besser als alle anderen. Wie kann ich es ihnen nur zeigen?« Aber ich denke, wir tappen in diese Fallen einfach hinein, in diese falschen Lebens-, Gottes- und Selbstbilder? Wir steuern unser Lebensschiff nicht absichtlich in stürmische Gewässer. Es ist vielmehr so, als wachten wir eines Morgens verloren auf weiter See auf und wüssten nicht, wie wir unseren Kurs wieder finden sollen. Jede Welle und jeder Sturm bringt uns immer weiter weg von unserem Ziel.
Bis sich etwas ändert.
Fortsetzung Teil 1 der Serie In Englisch
Quelle: Bryan c. Gallant, Undeniable, An Epic Journey Through Pain, 2015, Seite 20-26

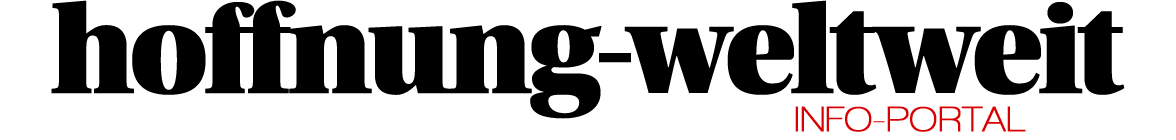

Schreibe einen Kommentar