»Manchmal wird man von einer Situation überrollt – man ist mitten in der dunkelsten Dunkelheit – und dann ändern sich plötzlich die Prioritäten. – Phoebe Snow
Ein Tag, wie viele andere?
Der 3. Dezember 1994 dämmerte wie viele gewöhnliche Tage zuvor. Penny und ich wachten auf, bereiteten uns auf einen neuen Tag vor und weckten unsere beiden lieben Kinder, Caleb (dreieinhalb Jahre alt) und Abigail (zehneinhalb Monate), aus ihrem süßen Schlummer. Dann stürzten wir uns in das Abenteuer, den beiden noch ganz verwirrten Kindern Nahrung einzuflößen, ohne zu viel Zeit zu verlieren und dabei zu viel zu kleckern. Nach einigem Drängeln und Überreden luden wir sie schließlich mit ihren Sachen in unseren Buick Skylark, Baujahr 1984 mit seinem schönen, undichten Schiebedach. Wir hatten ihn bei einem Gebrauchtwagenhändler erstanden, da unser vorheriges finanzielles Fiasko unsere Kaufmöglichkeiten und die Bandbreite der in Frage kommenden Fahrzeuge stark eingeschränkt hatte. Nach dem Frühstück fuhren wir um 7:00 Uhr los. Zweieinhalb Stunden Weg bis zu einer Kirche in Almond, Wisconsin, lagen vor uns.
Wir waren beide 26 Jahre alt und nun schon seit fast fünfeinhalb Jahren verheiratet. Unser holperiger Start war einer eintönigen Ehe gewichen. Penny und ich hatten uns aneinander, an unser Versagen und an die Schwächen unserer Generation gewöhnt. Wir gaben unser Bestes, und das trotz der Einschränkungen, die wir unserer Wahl zu verdanken hatten. Ich weiß nicht, ob Penny oder ich damals gesagt hätten, dass wir wirklich glücklich waren. Ich glaube, wir waren beide immer noch so jung und unreif, dass wir weder wussten, wie wir miteinander glücklich sein konnten, noch jeder für sich. Die wiederholten Verwundungen hatten das Glück allenfalls zu einer vorübergehenden Zeiterscheinung reduziert. Mit zwei kleinen Kindern hatte sich der Kampf zu lieben und geliebt zu werden dann weiter verkompliziert.
Nach der Fehlgeburt ein paar Jahre zuvor hatten wir es wieder versucht. Ursprünglich hatte ich keine Kinder gewollt. Ich hatte das Penny sogar von Anfang an gesagt und es damals auf Chuuk zu einer Vorbedingung fürs Heiraten gemacht. Sie war einverstanden gewesen, hatte ihre Meinung aber geändert, als wir verheiratet waren. Es gefiel mir nicht, dass sie ihre Meinung geändert hatte, und es führte zu weiteren Spannungen. Mitten in meinem finanziellen Versagen als Mann, ihrem kürzlichen Verlust des Kindes durch die Fehlgeburt und meiner Unfähigkeit, ihr Geborgenheit zu geben, als sie es gebraucht hätte, drängte sie immer mehr auf ein Baby, das sie lieben könnte und das ihr wieder Freude schenken würde. Schließlich hatte ihr beharrliches Nörgeln zur Geburt von Caleb geführt und später zur Geburt von Abigail. Wir waren dankbar und liebten die beiden natürlich, so gut wir konnten. Doch manchmal traten die alten Spannungen wieder auf.
Caleb war ein freundlich gestimmter, schüchterner Junge. Süß, blond, schmächtig und liebevoll. Er ließ sich leicht belehren, fast schon bedrohlich leicht. Ein scharfer Blick reichte völlig aus. Abigail war lebendiger und ausdrucksvoller. Sie liebte Umarmungen und Essen und war ein glückliches Baby. Die Mahlzeiten waren besonders schöne Augenblicke. Obwohl ich keine Kinder gewollt hatte, freute ich mich auf nichts so wie darauf, nach der Arbeit nach Hause zu unserem gemieteten Wohnwagen zu kommen und zu hören, wie Caleb rief: »Papa ist da!« Dann rannte er zu Tür und Abi-Joe, wie er sie nannte, krabbelte ihm nach. Caleb und Abigail waren der Segen unseres Lebens und brachten frischen Wind in unsere schlaffen Segel, auch wenn mir das damals gar nicht so bewusst war.
An jenem Morgen erinnere ich mich jedoch genau, wie Penny und ich auf dem Weg in die Kirche über irgendeine Kleinigkeit stritten. Das trübte unsere gemeinsame Fahrt auf dem Weg zum Dienst an anderen. Schon komisch, wie man die Menschen, die einem am nächsten stehen, verletzen kann, während man gleichzeitig vorhat, den Menschen, die einem mehr oder weniger fremd sind, zum Segen zu werden. Vielleicht ist es leichter, Menschen zu lieben, die man nicht kennt? Oder es ist einfach eine Fassade, die so glaubhaft ist, weil man sie immer nur kurzzeitig aufrechterhalten muss.
Ich predigte regelmäßig als Volontär in kleinen ländlichen Kirchen und half verschiedenen Pastoren, die einen Bezirk mit zwei oder mehr Gemeindegruppen hatten. Ein professioneller Redner war ich nicht, ein Pastor ebenso wenig. Ich verkaufte lediglich Bücher über die Bibel von Tür zu Tür. Dafür hatte ich Geschichten von Gottes Wundern zu erzählen oder wenigstens von Menschen, die meine Bücher kauften, damit meine Familie ausreichend zu essen hatte. Immer hatte ich genug neue Abenteuer zu berichten, und das reichte anscheinend aus, dass diese Kirchen uns einluden. Kein Schulabschluss, kein Titel, keine Ausbildung, aber ein bereitwilliger Geschichtenerzähler. Normalerweise fuhren wir gerne als Familie in andere Kirchen. Doch an diesem Morgen hatte die Freude in unserem Auto keinen Sitzplatz.
Meine Predigt in der Kirche
Die kleine Kirche ähnelte vielen anderen, die wir vorher besucht hatten. Sie machte einen freundlichen und gemütlichen Eindruck. An architektonische Besonderheiten kann ich mich nicht erinnern. Ein einfaches Gemeindegebäude auf dem Land, das nach einer stressigen Arbeitswoche zum Gottesdienst am Wochenende einlud.
Wir reaktivierten unser Lächeln, als wir aus dem Auto ausstiegen. Das fröhliche Begrüßungskomitee an der Tür schüttelte uns die Hand und führte Penny, Caleb und Abigail in die Kindergruppe. Ich ging in den Saal, wo sich die Erwachsenen versammelten, und schaute mir diese Gemeinde aus dem Blickwinkel eines Außenstehenden an. Als Sohn eines Soldaten hatte ich mich an das Umziehen gewöhnt. Daher fühlte ich mich in der Rolle des Außenseiters überall zu Hause. Wie ein Chamäleon, das sich fragt, welche Farbe jetzt die sicherste ist, beobachtete ich zuerst genau, bevor ich zu erkennen gab, wer ich an jenem Tag und in jener besonderen Runde war. Die moderne Forschung bezeichnet mich deshalb als »Drittkulturkind«. Von den Argumenten her stimme ich dem zu – vom Gefühl her, spüre ich oft, dass es nicht ganz zutrifft!
Das Bibelgespräch im Kreis der Erwachsenen gefiel mir. Ob es an jenem Tag sehr kontrovers war, weiß ich nicht mehr. Doch normalerweise setzte die Kontroverse schnell ein, wenn zwei oder mehr über Gott und die Bibel sprachen. Ich frage mich, warum die schönsten Themen manchmal die hässlichsten Seiten in uns zum Vorschein bringen. Aber es ist häufig der Fall! Nach und nach merkte ich mir ein paar Streitpunkte und ein paar Themen, die ich in meiner Predigt ansprechen konnte. Rückblickend kommt es mir recht stolz vor für einen 26-Jährigen, wenn er die Glieder einer Kirche in wenigen Augenblicken einschätzen will, um dann Gottes Wort Menschen zu predigen die Jahrzehnte älter und weiser sind als er! Ich vermute, kleine Gemeinden sind dankbar, wenn jemand einfach nur bereit ist zu kommen. Vielleicht freute sich sogar Gott schlussendlich, dass er einen Unwissenden für andere zum Segen einsetzen konnte. Ohne Abschluss und akademischen Titel war ich an jenem Tag ganz bestimmt ein unwissendes Werkzeug in seiner Hand. Merkwürdigerweise war ich so jung und unerfahren, dass ich die Ironie dieser Unwissenheit in diesem Moment nicht mal bemerkte!
An jenem Tag predigte ich über Ebenezer. Nein, nicht über Ebenezer Scrooge aus Charles Dickens Christmas Carol, sondern über Ebenezer aus der Bibel: einen Stein. Der Stein mit der Bedeutung: »Bis hierher hat uns Gott geholfen.« Der Prophet Samuel hatte die Israeliten aufgefordert, ihn nach einem bemerkenswerten Wunder aufzurichten. Es war eine schlichte Predigt, die betonte, dass jeder einen Stein, oder auch Steine, im Gedenken an Situation aufrichten darf, wo er Gottes Führung erlebt hat. Dabei müsse man sich nicht auf Geschichten längst vergangener Ereignisse beschränken oder auf Geschichten von Giganten und Pionieren des Glaubens. Nein, jeder solle an die ganz persönlichen Geschichten denken, die erzählen, wie und wann Gott eingegriffen hat. Schreib sie auf, meißele sie in Stein, hänge sie an die Wand: Gedenke ihrer! Das ist es! Wir haben nichts für die Zukunft zu befürchten, wenn wir aktiv Buch führen über das, was Gott in unserem Leben in der Vergangenheit getan hat! Das war meine Ebenezer-Predigt. Sie bestand aus drei Punkten, veranschaulicht durch drei Geschichten aus meinem Leben oder dem, was ich gelesen hatte. Nett. Pfiffig. Schlicht. Ich glaubte an meine Predigt. Ich brachte sie mit Überzeugung. Ja, Gott hatte deutlich in meinem Leben gewirkt und ich wollte andere einladen, nicht zu vergessen, wie er auch für sie gewirkt hatte.
Nach der Predigt aßen wir zu Mittag. Dann bestiegen wir wieder das Auto, um nach Hause zu fahren. Als ich Caleb in seinem Autositz anschnallte, lächelte er und sagte: »Es ist kalt, Papa.« Ich lächelte zurück, sagte, dass alles in Ordnung sei, und fühlte mich spürbar erleichtert. Denn ich wusste: Meine Aufgabe für heute war erfüllt; ich konnte entspannen. Wir beteten, dankten Gott für das Werk, das er hier getan hatte, und baten um Schutz auf dem Heimweg.
Doch irgendwo zwischen Almond und Fall River, Wisconsin, geschah etwas. Unseren netten Gebeten und unserer aufrichtigen Hingabe zum Trotz würde sich unser Leben unwiederbringlich ändern. Ich ahnte nicht, dass Gottes Werk an diesem Tag erst begonnen hatte, und dies auf eine Weise, die ich mir nie hätte vorstellen können noch aussuchen wollen!
Der Unfall, der alles veränderte
Als wir aus dem kleinen Städtchen hinausfuhren, stellte ich meine Rückenlehne etwas nach hinten, um mich ein wenig auszuruhen, während meine Frau uns nach Hause fuhr. Ich weiß nicht mehr, wie schnell ich einschlief. Doch an einem Punkt bekam ich nicht mehr mit, was geschah. Caleb und Abigail auf der Rückbank schliefen ebenfalls.
Plötzlich wachte ich erschreckt durch den Schrei meiner Frau auf.
Ich schnellte aus meinem leicht zurückgelehnten Sitz vor und sah gerade noch zwei Dinge: den völlig entsetzten Blick meiner Frau und dann ein anderes Auto, das uns überholte, während unser Auto rechts von der Schnellstraße abkam. Im Bruchteil einer Sekunde, bevor ich etwas tun konnte, überschlug sich das Auto seitlich dreimal bei einer Geschwindigkeit von etwa 100 km/h, als es die Böschung hinabrollte. Die Fahrerseite erlitt den ersten starken Aufprall. Als das Auto das erste Mal aufschlug, befand ich mich also auf der dem Aufprall abgewandten Seite. Bei jeder Umdrehung schien ich eine Stimme zu hören oder einen Eindruck, der sagte: »Zieh den Kopf ein!«, was ich auch tat. Die Zeit schien im Zeitlupentempo zu vergehen. Das Geräusch von zerschmetterndem Blech, ein Schrei, splitterndes Glas, ein kalter Luftzug – alles stürmte auf meine Sinne ein. Schließlich ein dumpfer Schlag und Stille.
War es ein Traum? Ein schrecklicher Traum? Hatte mein Mittagsschläfchen dieses makabere Schauspiel ersponnen?
Als meine unfreiwillige Achterbahn zum Stillstand kam, dröhnte mein Kopf und mein Fußgelenk schmerzte. Ansonsten war ich aber bei Bewusstsein. Es war kein Traum, so sehr ich es mir auch wünschte.
Manchmal ist Bewusstlosigkeit Gnade.
Wie in der unheimlichen Stille nach dem Sturm horchte ich auf und bemerkte, dass der Motor immer noch lief. Ich schaltete ihn aus. Denn ich erinnerte mich sofort, dass Benzin in solchen Situationen explodieren kann. Dabei sah ich, dass meine Frau in ihrem Sitz zusammengesunken war. Sie bewegte sich nicht. Blut. Erbrochenes. Ihr Haar und ihr Gesicht waren verfilzt und entstellt von einer kaum definierbaren Mischung aus Flüssigkeiten und Glassplittern. Die Fenster waren alle weg und die Windschutzscheibe hing nur noch an ihrer Beschichtung. Ich versuchte meine Tür zu öffnen; sie klemmte. Ein fühlbares, unerträgliches Grauen beschlich mich. War meine Frau tot? Ich rief ihren Namen. Sie bewegte sich nicht. Dann drehte ich mich nach meinen Kindern um.
Als ich den Kopf nach links drehte und dabei einen stechenden Schmerz fühlte, erblickte ich etwas, was ich nie mehr vergessen werde, obwohl ich tausendfach darum gebeten habe, dass ich es vergessen kann! Als ich zur Rückbank schaute, wo meine beiden Kinder sein sollten, graute mir vor dem, was meine Augen sahen. Da saß meine kleine Abigail nicht in ihrem Kindersitz sicher angeschnallt und vor dem Aufprall geschützt, sondern sie hing aus dem hinteren Fenster, gehalten vom Sicherheitsgurt, der versagt und sich in eine Schlinge verwandelt hatte! Die andere Seite der Rückbank, wo Caleb hätte sitzen sollen, war leer. Wo war mein Junge? Ein unaussprechliches Grauen bemächtigte sich meiner.
Während die Trauer und der völlige Zusammenbruch meiner Welt mich zu erdrücken drohten, spürte ich, wie ein unkontrollierbarer Vaterinstinkt aus meinem Inneren hervorbrach, der meine Tochter retten wollte. Mein Gehirn schaltete in den vollen Eltern-Power-Modus. Wie konnte ich so schnell wie möglich zu ihr gelangen? Würde ich rechtzeitig kommen? Die Fragen, die Angst, die Kraft, die Dringlichkeit ergriffen von mir derartig Besitz, dass ich mich heute nicht mehr erinnern kann, was ich damals getan habe. Konnte ich die Tür mit Gewalt öffnen? Kroch ich durchs Fenster? Wie kam ich dorthin? Die Gefühle waren so stark, dass ich es nicht mehr weiß. Ich erinnere mich nur noch an die quälende Finsternis jener Gefühle, die mich in diesen 15 intensiven Sekunden überkamen. Als ich schließlich neben ihr war, sie in den Arm nahm und aus dem Gurt befreite, spürten meine Hände, wie schlaff und reaktionslos sie war. Ich war zu spät gekommen.
Jetzt packte mich eine neue Panik. Wo war Caleb? Mit meiner kleinen Tochter in Händen, fast vernichtet von der Hoffnungslosigkeit des Augenblicks, begann ich nach ihm zu suchen. Er war offensichtlich aus dem Fahrzeug geschleudert worden. Verzweifelt lief ich von einer Seite zur anderen, hielt meine Tochter eng an die Brust gedrückt, wünschte mit meinem ganzen Sein, dass ich ihr etwas von meinem Leben geben könnte und suchte nach Caleb. Mit jeder verstreichenden Sekunde wuchs die Hoffnungslosigkeit. Schließlich sah ich ihn, fast 30 Meter entfernt, bewegungslos im Gras liegen. Ich rannte zu ihm und legte Abigail vorsichtig neben ihn, um zu sehen, ob es ihm gut ging. Keine Reaktion. Keine Antwort. Sein Brustkorb bewegte sich nicht. Wieder war ich zu spät gekommen.
Ich erinnere mich, dass ich Caleb auf die Stirn küsste. Ich wusste nicht warum. Vielleicht dachte ich, dass der Kuss eines Vaters etwas bewirken könne. Doch vergeblich. Da kniete ich, umgeben von denen, die einst meine Familie gewesen waren. Caleb und Abigail lagen vor mir, gebrochen und unbeweglich. Meine Frau war eingeschlossen in einem zerdrückten Fahrzeug wenige Meter entfernt. Das zugerichtete Blech unseres Buick war nun ein treffendes Symbol für meine Welt. Ich stand auf, stolperte ziellos in der Leere zwischen meinen Kindern und meiner Frau umher und schrie: »Gott! Wo bist du?«
So kurz nach meiner Predigt! Wo waren jetzt die Steine, wo war mein Ebenezer? Alles war dahingerafft!
Fortsetzung Teil 1 der Serie In Englisch
Quelle: Bryan C. Gallant, Undeniable, An Epic Journey Through Pain, 2015, Seite 27-34

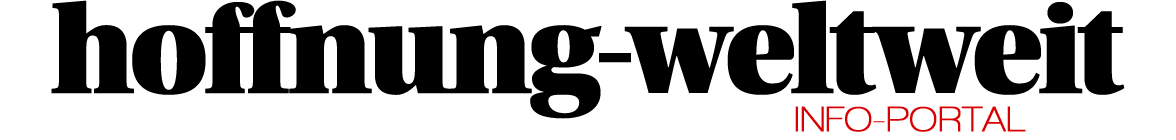

Schreibe einen Kommentar